Fleurs du Mal Magazine


Or see the index

Gertrude Stein
Cézanne
The Irish lady can say, that to-day is every day. Caesar can say that
every day is to-day and they say that every day is as they say.
In this way we have a place to stay and he was not met because
he was settled to stay. When I said settled I meant settled to stay.
When I said settled to stay I meant settled to stay Saturday. In this
way a mouth is a mouth. In this way if in as a mouth if in as a
mouth where, if in as a mouth where and there. Believe they have
water too. Believe they have that water too and blue when you see
blue, is all blue precious too, is all that that is precious too is all
that and they meant to absolve you. In this way Cézanne nearly did
nearly in this way. Cézanne nearly did nearly did and nearly did.
And was I surprised. Was I very surprised. Was I surprised. I was
surprised and in that patient, are you patient when you find bees.
Bees in a garden make a specialty of honey and so does honey. Honey
and prayer. Honey and there. There where the grass can grow nearly
four times yearly.
Gertrude Stein (1874-1946) poetry
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive S-T, Stein, Gertrude

Emile Verhaeren
L’âge est venu, pas à pas, jour à jour
L’âge est venu, pas à pas, jour à jour,
Poser ses mains sur le front nu de notre amour
Et, de ses yeux moins vifs, l’a regardé.
Et, dans le beau jardin que Juillet a ridé,
Les fleurs, les bosquets et les feuilles vivantes
Ont laissé choir un peu de leur force fervente
Sur l’étang pâle et sur les chemins doux.
Parfois, le soleil marque, âpre et jaloux,
Une ombre dure, autour de sa lumière.
Pourtant, voici toujours les floraisons trémières
Qui persistent à se darder vers leur splendeur,
Et les saisons ont beau peser sur notre vie,
Toutes les racines de nos deux coeurs
Plus que jamais plongent inassouvies,
Et se crispent et s’enfoncent, dans le bonheur.
Oh ! ces heures d’après-midi ceintes de roses
Qui s’enlacent autour du temps et se reposent
La joue en fleur et feu, contre son flanc transi !
Et rien, rien n’est meilleur que se sentir ainsi,
Heureux et clairs encor, après combien d’années !
Mais si tout autre avait été la destinée
Et que, tous deux, nous eussions dû souffrir,
– Quand même ! – oh ! j’eusse aimé vivré et mourir,
Sans me plaindre, d’une amour obstinée.
Emile Verhaeren (1855-1916) poésie
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive U-V, Verhaeren, Emile

Hart Crane
(1889 – 1932)
North Labrador
A land of leaning ice
Hugged by plaster-grey arches of sky,
Flings itself silently
Into eternity.
“Has no one come here to win you,
Or left you with the faintest blush
Upon your glittering breasts?
Have you no memories, O Darkly Bright?”
Cold-hushed, there is only the shifting moments
That journey toward no Spring –
No birth, no death, no time nor sun
In answer.
Hart Crane poetry
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive C-D, Crane, Hart
 Franz Kafka
Franz Kafka
Beim Bau der Chinesischen Mauer
Die Chinesische Mauer ist an ihrer nördlichsten Stelle beendet worden. Von Südosten und Südwesten wurde der Bau herangeführt und hier vereinigt. Dieses System des Teilbaues wurde auch im Kleinen innerhalb der zwei großen Arbeitsheere, des Ost- und des Westheeres, befolgt. Es geschah das so, daß Gruppen von etwa zwanzig Arbeitern gebildet wurden, welche eine Teilmauer von etwa fünfhundert Metern Länge aufzuführen hatten, eine Nachbargruppe baute ihnen dann eine Mauer von gleicher Länge entgegen. Nachdem dann aber die Vereinigung vollzogen war, wurde nicht etwa der Bau am Ende dieser tausend Meter wieder fortgesetzt, vielmehr wurden die Arbeitergruppen wieder in ganz andere Gegenden zum Mauerbau verschickt. Natürlich entstanden auf diese Weise viele große Lücken, die erst nach und nach langsam ausgefüllt wurden, manche sogar erst, nachdem der Mauerbau schon als vollendet verkündigt worden war. Ja, es soll Lücken geben, die überhaupt nicht verbaut worden sind, eine Behauptung allerdings, die möglicherweise nur zu den vielen Legenden gehört, die um den Bau entstanden sind, und die, für den einzelnen Menschen wenigstens, mit eigenen Augen und eigenem Maßstab infolge der Ausdehnung des Baues unnachprüfbar sind.
Nun würde man von vornherein glauben, es wäre in jedem Sinne vorteilhafter gewesen, zusammenhängend zu bauen oder wenigstens zusammenhängend innerhalb der zwei Hauptteile. Die Mauer war doch, wie allgemein verbreitet wird und bekannt ist, zum Schutze gegen die Nordvölker gedacht. Wie kann aber eine Mauer schützen, die nicht zusammenhängend gebaut ist. Ja, eine solche Mauer kann nicht nur nicht schützen, der Bau selbst ist in fortwährender Gefahr. Diese in öder Gegend verlassen stehenden Mauerteile können immer wieder leicht von den Nomaden zerstört werden, zumal diese damals, geängstigt durch den Mauerbau, mit unbegreiflicher Schnelligkeit wie Heuschrecken ihre Wohnsitze wechselten und deshalb vielleicht einen besseren Überblick über die Baufortschritte hatten als selbst wir, die Erbauer. Trotzdem konnte der Bau wohl nicht anders ausgeführt werden, als es geschehen ist. Um das zu verstehen, muß man folgendes bedenken: Die Mauer sollte zum Schutz für die Jahrhunderte werden; sorgfältigster Bau, Benützung der Bauweisheit aller bekannten Zeiten und Völker, dauerndes Gefühl der persönlichen Verantwortung der Bauenden waren deshalb unumgängliche Voraussetzung für die Arbeit. Zu den niederen Arbeiten konnten zwar unwissende Taglöhner aus dem Volke, Männer, Frauen, Kinder, wer sich für gutes Geld anbot, verwendet werden; aber schon zur Leitung von vier Taglöhnern war ein verständiger, im Baufach gebildeter Mann nötig; ein Mann, der imstande war, bis in die Tiefe des Herzens mitzufühlen, worum es hier ging. Und je höher die Leistung, desto größer die Anforderungen. Und solche Männer standen tatsächlich zur Verfügung, wenn auch nicht in jener Menge, wie sie dieser Bau hätte verbrauchen können, so doch in großer Zahl.
Man war nicht leichtsinnig an das Werk herangegangen. Fünfzig Jahre vor Beginn des Baues hatte man im ganzen China, das ummauert werden sollte, die Baukunst, insbesondere das Maurerhandwerk, zur wichtigsten Wissenschaft erklärt und alles andere nur anerkannt, soweit es damit in Beziehung stand. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie wir als kleine Kinder, kaum unserer Beine sicher, im Gärtchen unseres Lehrers standen, aus Kieselsteinen eine Art Mauer bauen mußten, wie der Lehrer den Rock schützte, gegen die Mauer rannte, natürlich alles zusammenwarf, und uns wegen der Schwäche unseres Baues solche Vorwürfe machte, daß wir heulend uns nach allen Seiten zu unseren Eltern verliefen. Ein winziger Vorfall, aber bezeichnend für den Geist der Zeit.
Ich hatte das Glück, daß, als ich mit zwanzig Jahren die oberste Prüfung der untersten Schule abgelegt hatte, der Bau der Mauer gerade begann. Ich sage Glück, denn viele, die früher die oberste Höhe der ihnen zugänglichen Ausbildung erreicht hatten, wußten jahrelang mit ihrem Wissen nichts anzufangen, trieben sich, im Kopf die großartigsten Baupläne, nutzlos herum und verlotterten in Mengen. Aber diejenigen, die endlich als Bauführer, sei es auch untersten Ranges, zum Bau kamen, waren dessen tatsächlich würdig. Es waren Maurer, die viel über den Bau nachgedacht hatten und nicht aufhörten, darüber nachzudenken, die sich mit dem ersten Stein, den sie in den Boden einsenken ließen, dem Bau verwachsen fühlten. Solche Maurer trieb aber natürlich, neben der Begierde, gründlichste Arbeit zu leisten, auch die Ungeduld, den Bau in seiner Vollkommenheit endlich erstehen zu sehen. Der Taglöhner kennt diese Ungeduld nicht, den treibt nur der Lohn, auch die oberen Führer, ja selbst die mittleren Führer sehen von dem vielseitigen Wachsen des Baues genug, um sich im Geiste dadurch kräftig zu halten. Aber für die unteren, geistig weit über ihrer äußerlich kleinen Aufgabe stehenden Männer, mußte anders vorgesorgt werden. Man konnte sie nicht zum Beispiel in einer unbewohnten Gebirgsgegend, hunderte Meilen von ihrer Heimat, Monate oder gar Jahre lang Mauerstein an Mauerstein fügen lassen; die Hoffnungslosigkeit solcher fleißigen, aber selbst in einem langen Menschenleben nicht zum Ziel führenden Arbeit hätte sie verzweifelt und vor allem wertloser für die Arbeit gemacht. Deshalb wählte man das System des Teilbaues. Fünfhundert Meter konnten etwa in fünf Jahren fertiggestellt werden, dann waren freilich die Führer in der Regel zu erschöpft, hatten alles Vertrauen zu sich, zum Bau, zur Welt verloren. Drum wurden sie dann, während sie noch im Hochgefühl des Vereinigungsfestes der tausend Meter Mauer standen, weit, weit verschickt, sahen auf der Reise hier und da fertige Mauerteile ragen, kamen an Quartieren höherer Führer vorüber, die sie mit Ehrenzeichen beschenkten, hörten den Jubel neuer Arbeitsheere, die aus der Tiefe der Länder herbeiströmten, sahen Wälder niederlegen, die zum Mauergerüst bestimmt waren, sahen Berge in Mauersteine zerhämmern, hörten auf den heiligen Stätten Gesänge der Frommen Vollendung des Baues erflehen. Alles dieses besänftigte ihre Ungeduld. Das ruhige Leben der Heimat, in der sie einige Zeit verbrachten, kräftigte sie, das Ansehen, in dem alle Bauenden standen, die gläubige Demut, mit der ihre Berichte angehört wurden, das Vertrauen, das der einfache, stille Bürger in die einstige Vollendung der Mauer setzte, alles dies spannte die Saiten der Seele. Wie ewig hoffende Kinder nahmen sie dann von der Heimat Abschied, die Lust, wieder am Volkswerk zu arbeiten, wurde unbezwinglich. Sie reisten früher von Hause fort, als es nötig gewesen wäre, das halbe Dorf begleitete sie lange Strecken weit. Auf allen Wegen Gruppen, Wimpel, Fahnen, niemals hatten sie gesehen, wie groß und reich und schön und liebenswert ihr Land war. Jeder Landmann war ein Bruder, für den man eine Schutzmauer baute, und der mit allem, was er hatte und war, sein Leben lang dafür dankte. Einheit! Einheit! Brust an Brust, ein Reigen des Volkes, Blut, nicht mehr eingesperrt im kärglichen Kreislauf des Körpers, sondern süß rollend und doch wiederkehrend durch das unendliche China.
Dadurch also wird das System des Teilbaues verständlich; aber es hatte doch wohl noch andere Gründe. Es ist auch keine Sonderbarkeit, daß ich mich bei dieser Frage so lange aufhalte, es ist eine Kernfrage des ganzen Mauerbaues, so unwesentlich sie zunächst scheint. Will ich den Gedanken und die Erlebnisse jener Zeit vermitteln und begreiflich machen, kann ich gerade dieser Frage nicht tief genug nachbohren.
Zunächst muß man sich doch wohl sagen, daß damals Leistungen vollbracht worden sind, die wenig hinter dem Turmbau von Babel zurückstehen, an Gottgefälligkeit allerdings, wenigstens nach menschlicher Rechnung, geradezu das Gegenteil jenes Baues darstellen. Ich erwähne dies, weil in den Anfangszeiten des Baues ein Gelehrter ein Buch geschrieben hat, in welchem er diese Vergleiche sehr genau zog. Er suchte darin zu beweisen, daß der Turmbau zu Babel keineswegs aus den allgemein behaupteten Ursachen nicht zum Ziele geführt hat, oder daß wenigstens unter diesen bekannten Ursachen sich nicht die allerersten befinden. Seine Beweise bestanden nicht nur aus Schriften und Berichten, sondern er wollte auch am Orte selbst Untersuchungen angestellt und dabei gefunden haben, daß der Bau an der Schwäche des Fundamentes scheiterte und scheitern mußte. In dieser Hinsicht allerdings war unsere Zeit jener längst vergangenen weit überlegen. Fast jeder gebildete Zeitgenosse war Maurer vom Fach und in der Frage der Fundamentierung untrüglich. Dahin zielte aber der Gelehrte gar nicht, sondern er behauptete, erst die große Mauer werde zum erstenmal in der Menschenzeit ein sicheres Fundament für einen neuen Babelturm schaffen. Also zuerst die Mauer und dann der Turm. Das Buch war damals in aller Hände, aber ich gestehe ein, daß ich noch heute nicht genau begreife, wie er sich diesen Turmbau dachte. Die Mauer, die doch nicht einmal einen Kreis, sondern nur eine Art Viertel- oder Halbkreis bildete, sollte das Fundament eines Turmes abgeben? Das konnte doch nur in geistiger Hinsicht gemeint sein. Aber wozu dann die Mauer, die doch etwas Tatsächliches war, Ergebnis der Mühe und des Lebens von Hunderttausenden? Und wozu waren in dem Werk Pläne, allerdings nebelhafte Pläne, des Turmes gezeichnet und Vorschläge bis ins einzelne gemacht, wie man die Volkskraft in dem kräftigen neuen Werk zusammenfassen solle?
Es gab – dieses Buch ist nur ein Beispiel – viel Verwirrung der Köpfe damals, vielleicht gerade deshalb, weil sich so viele möglichst auf einen Zweck hin zu sammeln suchten. Das menschliche Wesen, leichtfertig in seinem Grund, von der Natur des auffliegenden Staubes, verträgt keine Fesselung; fesselt es sich selbst, wird es bald wahnsinnig an den Fesseln zu rütteln anfangen und Mauer, Kette und sich selbst in alle Himmelsrichtungen zerreißen.
Es ist möglich, daß auch diese, dem Mauerbau sogar gegensätzlichen Erwägungen von der Führung bei der Festsetzung des Teilbaues nicht unberücksichtigt geblieben sind. Wir – ich rede hier wohl im Namen vieler – haben eigentlich erst im Nachbuchstabieren der Anordnungen der obersten Führerschaft uns selbst kennengelernt und gefunden, daß ohne die Führerschaft weder unsere Schulweisheit noch unser Menschenverstand für das kleine Amt, das wir innerhalb des großen Ganzen hatten, ausgereicht hätte. In der Stube der Führerschaft – wo sie war und wer dort saß, weiß und wußte niemand, den ich fragte – in dieser Stube kreisten wohl alle menschlichen Gedanken und Wünsche und in Gegenkreisen alle menschlichen Ziele und Erfüllungen. Durch das Fenster aber fiel der Abglanz der göttlichen Welten auf die Pläne zeichnenden Hände der Führerschaft.
Und deshalb will es dem unbestechlichen Betrachter nicht eingehen, daß die Führerschaft, wenn sie es ernstlich gewollt hätte, nicht auch jene Schwierigkeiten hätte überwinden können, die einem zusammenhängenden Mauerbau entgegenstanden. Bleibt also nur die Folgerung, daß die Führerschaft den Teilbau beabsichtigte. Aber der Teilbau war nur ein Notbehelf und unzweckmäßig. Bleibt die Folgerung, daß die Führerschaft etwas Unzweckmäßiges wollte. – Sonderbare Folgerung! – Gewiß, und doch hat sie auch von anderer Seite manche Berechtigung für sich. Heute kann davon vielleicht ohne Gefahr gesprochen werden. Damals war es geheimer Grundsatz Vieler, und sogar der Besten: Suche mit allen deinen Kräften die Anordnungen der Führerschaft zu verstehen, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, dann höre mit dem Nachdenken auf. Ein sehr vernünftiger Grundsatz, der übrigens noch eine weitere Auslegung in einem später oft wiederholten Vergleich fand: Nicht weil es dir schaden könnte, höre mit dem weiteren Nachdenken auf, es ist auch gar nicht sicher, daß es dir schaden wird. Man kann hier überhaupt weder von Schaden noch Nichtschaden sprechen. Es wird dir geschehen wie dem Fluß im Frühjahr. Er steigt, wird mächtiger, nährt kräftiger das Land an seinen langen Ufern, behält sein eignes Wesen weiter ins Meer hinein und wird dem Meere ebenbürtiger und willkommener. – So weit denke den Anordnungen der Führerschaft nach. – Dann aber übersteigt der Fluß seine Ufer, verliert Umrisse und Gestalt, verlangsamt seinen Abwärtslauf, versucht gegen seine Bestimmung kleine Meere ins Binnenland zu bilden, schädigt die Fluren, und kann sich doch für die Dauer in dieser Ausbreitung nicht halten, sondern rinnt wieder in seine Ufer zusammen, ja trocknet sogar in der folgenden heißen Jahreszeit kläglich aus. – So weit denke den Anordnungen der Führerschaft nicht nach.
Nun mag dieser Vergleich während des Mauerbaues außerordentlich treffend gewesen sein, für meinen jetzigen Bericht hat er doch zum mindesten nur beschränkte Geltung. Meine Untersuchung ist doch nur eine historische; aus den längst verflogenen Gewitterwolken zuckt kein Blitz mehr, und ich darf deshalb nach einer Erklärung des Teilbaues suchen, die weitergeht als das, womit man sich damals begnügte. Die Grenzen, die meine Denkfähigkeit mir setzt, sind ja eng genug, das Gebiet aber, das hier zu durchlaufen wäre, ist das Endlose.
Gegen wen sollte die große Mauer schützen? Gegen die Nordvölker. Ich stamme aus dem südöstlichen China. Kein Nordvolk kann uns dort bedrohen. Wir lesen von ihnen in den Büchern der Alten, die Grausamkeiten, die sie ihrer Natur gemäß begehen, machen uns aufseufzen in unserer friedlichen Laube. Auf den wahrheitsgetreuen Bildern der Künstler sehen wie diese Gesichter der Verdammnis, die aufgerissenen Mäuler, die mit hoch zugespitzten Zähnen besteckten Kiefer, die verkniffenen Augen, die schon nach dein Raub zu schielen scheinen, den das Maul zermalmen und zerreißen wird. Sind die Kinder böse, halten wir ihnen diese Bilder hin und schon fliegen sie weinend an unsern Hals. Aber mehr wissen wir von diesen Nordländern nicht. Gesehen haben wir sie nicht, und bleiben wir in unserem Dorf, werden wir sie niemals sehen, selbst wenn sie auf ihren wilden Pferden geradeaus zu uns hetzen und jagen, – zu groß ist das Land und läßt sie nicht zu uns, in die leere Luft werden sie sich verrennen.
Warum also, da es sich so verhält, verlassen wir die Heimat, den Fluß und die Brücken, die Mutter und den Vater, das weinende Weib, die lehrbedürftigen Kinder und ziehen weg zur Schule nach der fernen Stadt und unsere Gedanken sind noch weiter bei der Mauer im Norden? Warum? Frage die Führerschaft. Sie kennt uns. Sie, die ungeheure Sorgen wälzt, weiß von uns, kennt unser kleines Gewerbe, sieht uns alle zusammensitzen in der niedrigen Hütte und das Gebet, das der Hausvater am Abend im Kreise der Seinigen sagt, ist ihr wohlgefällig oder mißfällt ihr. Und wenn ich mir einen solchen Gedanken über die Führerschaft erlauben darf, so muß ich sagen, meiner Meinung nach bestand die Führerschaft schon früher, kam nicht zusammen, wie etwa hohe Mandarinen, durch einen schönen Morgentraum angeregt, eiligst eine Sitzung einberufen, eiligst beschließen, und schon am Abend die Bevölkerung aus den Betten trommeln lassen, um die Beschlüsse auszuführen, sei es auch nur um eine Illumination zu Ehren eines Gottes zu veranstalten, der sich gestern den Herren günstig gezeigt hat, um sie morgen, kaum sind die Lampions verlöscht, in einem dunklen Winkel zu verprügeln. Vielmehr bestand die Führerschaft wohl seit jeher und der Beschluß des Mauerbaues gleichfalls. Unschuldige Nordvölker, die glaubten, ihn verursacht zu haben, verehrungswürdiger, unschuldiger Kaiser, der glaubte, er hätte ihn angeordnet. Wir vom Mauerbau wissen es anders und schweigen.
Ich habe mich, schon damals während des Mauerbaues und nachher bis heute, fast ausschließlich mit vergleichender Völkergeschichte beschäftigt – es gibt bestimmte Fragen, denen man nur mit diesem Mittel gewissermaßen an den Nerv herankommt -und ich habe dabei gefunden, daß wir Chinesen gewisse volkliche und staatliche Einrichtungen in einzigartiger Klarheit, andere wieder in einzigartiger Unklarheit besitzen. Den Gründen, insbesondere der letzten Erscheinung, nachzuspüren, hat mich immer gereizt, reizt mich noch immer, und auch der Mauerbau ist von diesen Fragen wesentlich betroffen.
Nun gehört zu unseren allerundeutlichsten Einrichtungen jedenfalls das Kaisertum. In Peking natürlich, gar in der Hofgesellschaft, besteht darüber einige Klarheit, wiewohl auch diese eher scheinbar als wirklich ist. Auch die Lehrer des Staatsrechtes und der Geschichte an den hohen Schulen geben vor, über diese Dinge genau unterrichtet zu sein und diese Kenntnis den Studenten weitervermitteln zu können. Je tiefer man zu den unteren Schulen herabsteigt, desto mehr schwinden begreiflicherweise die Zweifel am eigenen Wissen, und Halbbildung wogt bergehoch um wenige seit Jahrhunderten eingerammte Lehrsätze, die zwar nichts an ewiger Wahrheit verloren haben, aber in diesem Dunst und Nebel auch ewig unerkannt bleiben.
Gerade über das Kaisertum aber sollte man meiner Meinung nach das Volk befragen, da doch das Kaisertum seine letzten Stützen dort hat. Hier kann ich allerdings wieder nur von meiner Heimat sprechen. Außer den Feldgottheiten und ihrem das ganze Jahr so abwechslungsreich und schön erfüllenden Dienst gilt unser Denken nur dem Kaiser. Aber nicht dem gegenwärtigen; oder vielmehr es hätte dem gegenwärtigen gegolten, wenn wir ihn gekannt, oder Bestimmtes von ihm gewußt hätten. Wir waren freilich – die einzige Neugierde, die uns erfüllte – immer bestrebt, irgend etwas von der Art zu erfahren, aber so merkwürdig es klingt, es war kaum möglich, etwas zu erfahren, nicht vom Pilger, der doch viel Land durchzieht, nicht in den nahen, nicht in den fernen Dörfern, nicht von den Schiffern, die doch nicht nur unsere Flüßchen, sondern auch die heiligen Ströme befahren. Man hörte zwar viel, konnte aber dem Vielen nichts entnehmen.
So groß ist unser Land, kein Märchen reicht an seine Größe, kaum der Himmel umspannt es – und Peking ist nur ein Punkt und das kaiserliche Schloß nur ein Pünktchen. Der Kaiser als solcher allerdings wiederum groß durch alle Stockwerke der Welt. Der lebendige Kaiser aber, ein Mensch wie wir, liegt ähnlich wie wir auf einem Ruhebett, das zwar reichlich bemessen, aber doch möglicherweise nur schmal und kurz ist. Wie wir streckt er manchmal die Glieder, und ist er sehr müde, gähnt er mit seinem zartgezeichneten Mund. Wie aber sollten wir davon erfahren – tausende Meilen im Süden -, grenzen wir doch schon fast ans tibetanischc Hochland. Außerdem aber käme jede Nachricht, selbst wenn sie uns erreichte, viel zu spät, wäre längst veraltet. Um den Kaiser drängt sich die glänzende und doch dunkle Menge des Hofstaates – Bosheit und Feindschaft im Kleid der Diener und Freunde -, das Gegengewicht des Kaisertums, immer bemüht, mit vergifteten Pfeilen den Kaiser von seiner Wagschale abzuschießen. Das Kaisertum ist unsterblich, aber der einzelne Kaiser fällt und stürzt ab, selbst ganze Dynastien sinken endlich nieder und veratmen durch ein einziges Röcheln. Von diesen Kämpfen und Leiden wird das Volk nie erfahren, wie Zu-spät-gekommene, wie Stadtfremde stehen sie am Ende der dichtgedrängten Seitengassen, ruhig zehrend vom mitgebrachten Vorrat, während auf dem Marktplatz in der Mitte weit vorn die Hinrichtung ihres Herrn vor sich geht.
Es gibt eine Sage, die dieses Verhältnis gut ausdrückt. Der Kaiser, so heißt es, hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft zugeflüstert; so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie noch ins Ohr wiedersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes – alle hindernden Wände werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reiches – vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht; ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann; einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge; findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist; er kommt auch leicht vorwärts wie kein anderer. Aber die Menge ist so groß; ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen und bald wohl hörtest Du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an Deiner Tür. Aber statt dessen, wie nutzlos müht er sich ab; immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes; niemals wird er sie überwinden; und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; die Treppen hinab müßte er sich kämpfen; und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; die Höfe wären zu durchmessen; und nach den Höfen der zweite umschließende Palast; und wieder Treppen und Höfe; und wieder ein Palast; und so weiter durch Jahrtausende; und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor – aber niemals, niemals kann es geschehen -, liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten. – Du aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie Dir, wenn der Abend kommt.
Genau so, so hoffnungslos und hoffnungsvoll, sieht unser Volk den Kaiser. Es weiß nicht, welcher Kaiser regiert, und selbst über den Namen der Dynastie bestehen Zweifel. In der Schule wird vieles dergleichen der Reihe nach gelernt, aber die allgemeine Unsicherheit in dieser Hinsicht ist so groß, daß auch der beste Schüler mit in sie gezogen wird. Längst verstorbene Kaiser werden in unseren Dörfern auf den Thron gesetzt, und der nur noch im Liede lebt, hat vor kurzem eine Bekanntmachung erlassen, die der Priester vor dem Altare verliest. Schlachten unserer ältesten Geschichte werden jetzt erst geschlagen und mit glühendem Gesicht fällt der Nachbar mit der Nachricht dir ins Haus. Die kaiserlichen Frauen, überfüttert in den seidenen Kissen, von schlauen Höflingen der edlen Sitten entfremdet, anschwellend in Herrschsucht, auffahrend in Gier, ausgebreitet in Wollust, verüben ihre Untaten immer wieder von neuem. Je mehr Zeit schon vergangen ist, desto schrecklicher leuchten alle Farben, und mit lautem Wehgeschrei erfährt einmal das Dorf, wie eine Kaiserin vor Jahrtausenden in langen Zügen ihres Mannes Blut trank.
So verfährt also das Volk mit den vergangenen, die gegenwärtigen Herrscher aber mischt es unter die Toten. Kommt einmal, einmal in einem Menschenalter, ein kaiserlicher Beamter, der die Provinz bereist, zufällig in unser Dorf, stellt im Namen der Regierenden irgendwelche Forderungen, prüft die Steuerlisten, wohnt dem Schulunterricht bei, befragt den Priester über unser Tun und Treiben, und faßt dann alles, ehe er in seine Sänfte steigt, in langen Ermahnungen an die herbeigetriebene Gemeinde zusammen, dann geht ein Lächeln über alle Gesichter, einer blickt verstohlen zum andern und beugt sich zu den Kindern hinab, um sich vom Beamten nicht beobachten zu lassen. Wie, denkt man, er spricht von einem Toten wie von einem Lebendigen, dieser Kaiser ist doch schon längst gestorben, die Dynastie ausgelöscht, der Herr Beamte macht sich über uns lustig, aber wir tun so, als ob wir es nicht merkten, um ihn nicht zu kränken. Ernstlich gehorchen aber werden wir nur unserem gegenwärtigen Herrn, denn alles andere wäre Versündigung. Und hinter der davoneilenden Sänfte des Beamten steigt irgendein willkürlich aus schon zerfallener Urne Gehobener aufstampfend als Herr des Dorfes auf.
Ähnlich werden die Leute bei uns von staatlichen Umwälzungen, von zeitgenössischen Kriegen in der Regel wenig betroffen. Ich erinnere mich hier an einen Vorfall aus meiner Jugend. In einer benachbarten, aber immerhin sehr weit entfernten Provinz war ein Aufstand ausgebrochen. Die Ursachen sind mir nicht mehr erinnerlich, sie sind hier auch nicht wichtig, Ursachen für Aufstände ergeben sich dort mit jedem neuen Morgen, es ist ein aufgeregtes Volk. Und nun wurde einmal ein Flugblatt der Aufständischen durch einen Bettler, der jene Provinz durchreist hatte, in das Haus meines Vaters gebracht. Es war gerade ein Feiertag, Gäste füllten unsere Stuben, in der Mitte saß der Priester und studierte das Blatt. Plötzlich fing alles zu lachen an, das Blatt wurde im Gedränge zerrissen, der Bettler, der allerdings schon reichlich beschenkt worden war, wurde mit Stößen aus dem Zimmer gejagt, alles zerstreute sich und lief in den schönen Tag. Warum? Der Dialekt der Nachbarprovinz ist von dem unseren wesentlich verschieden, und dies drückt sich auch in gewissen Formen der Schriftsprache aus, die für uns einen altertümlichen Charakter haben. Kaum hatte nun der Priester zwei derartige Seiten gelesen, war man schon entschieden. Alte Dinge, längst gehört, längst verschmerzt. Und obwohl – so scheint es mir in der Erinnerung – aus dem Bettler das grauenhafte Leben unwiderleglich sprach, schüttelte man lachend den Kopf und wollte nichts mehr hören. So bereit ist man bei uns, die Gegenwart auszulöschen.
Wenn man aus solchen Erscheinungen folgern wollte, daß wir im Grunde gar keinen Kaiser haben, wäre man von der Wahrheit nicht weit entfernt. Immer wieder muß ich sagen: Es gibt vielleicht kein kaisertreueres Volk als das unsrige im Süden, aber die Treue kommt dem Kaiser nicht zugute. Zwar steht auf der kleinen Säule am Dorfausgang der heilige Drache und bläst huldigend seit Menschengedenken den feurigen Atem genau in die Richtung von Peking – aber Peking selbst ist den Leuten im Dorf viel fremder als das jenseitige Leben. Sollte es wirklich ein Dorf geben, wo Haus an Haus steht, Felder bedeckend, weiter als der Blick von unserem Hügel reicht und zwischen diesen Häusern stünden bei Tag und bei Nacht Menschen Kopf an Kopf? Leichter als eine solche Stadt sich vorzustellen ist es uns, zu glauben, Peking und sein Kaiser wäre eines, etwa eine Wolke, ruhig unter der Sonne sich wandelnd im Laufe der Zeiten.
Die Folge solcher Meinungen ist nun ein gewissermaßen freies, unbeherrschtes Leben. Keineswegs sittenlos, ich habe solche Sittenreinheit, wie in meiner Heimat, kaum jemals angetroffen auf meinen Reisen. – Aber doch ein Leben, das unter keinem gegenwärtigen Gesetze steht und nur der Weisung und Warnung gehorcht, die aus alten Zeiten zu uns herüberreicht.
Ich hüte mich vor Verallgemeinerungen und behaupte nicht, daß es sich in allen zehntausend Dörfern unserer Provinz so verhält oder gar in allen fünfhundert Provinzen Chinas. Wohl aber darf ich vielleicht auf Grund der vielen Schriften, die ich über diesen Gegenstand gelesen habe, sowie auf Grund meiner eigenen Beobachtungen – besonders bei dem Mauerbau gab das Menschenmaterial dem Fühlenden Gelegenheit, durch die Seelen fast aller Provinzen zu reisen – auf Grund alles dessen darf ich vielleicht sagen, daß die Auffassung, die hinsichtlich des Kaisers herrscht, immer wieder und überall einen gewissen und gemeinsamen Grundzug mit der Auffassung in meiner Heimat zeigt. Die Auffassung will ich nun durchaus nicht als eine Tugend gelten lassen, im Gegenteil. Zwar ist sie in der Hauptsache von der Regierung verschuldet, die im ältesten Reich der Erde bis heute nicht imstande war oder dies über anderem vernachlässigte, die Institution des Kaisertums zu solcher Klarheit auszubilden, daß sie bis an die fernsten Grenzen des Reiches unmittelbar und unablässig wirke. Andererseits aber liegt doch auch darin eine Schwäche der Vorstellungs- oder Glaubenskraft beim Volke, welches nicht dazu gelangt, das Kaisertum aus der Pekinger Versunkenheit in aller Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit an seine Untertanenbrust zu ziehen, die doch nichts besseres will, als einmal diese Berührung zu fühlen und an ihr zu vergehen.
Eine Tugend ist also diese Auffassung wohl nicht. Um so auffälliger ist es, daß gerade diese Schwäche eines der wichtigsten Einigungsmittel unseres Volkes zu sein scheint; ja, wenn man sich im Ausdruck soweit vorwagen darf, geradezu der Boden, auf dem wir leben. Hier einen Tadel ausführlich begründen, heißt nicht an unserem Gewissen, sondern, was viel ärger ist, an unseren Beinen rütteln. Und darum will ich in der Untersuchung dieser Frage vorderhand nicht weiter gehen.
Franz Kafka
(1883-1924)
Beim Bau der Chinesischen Mauer
fleursdumalnl magazine
More in: Archive K-L, Franz Kafka, Kafka, Franz, Kafka, Franz

William Shakespeare
(1564-1616)
Lowliness
Lowliness is young ambition’s ladder,
Whereto the climber-upward turns his face;
But when he once attains the upmost round,
He then unto the ladder turns his back,
Looks in the clouds, scorning the base degrees
By which he did ascend
William Shakespeare, Julius Caesar, Act II, sc.1
Shakespeare 400 (1616 – 2016)
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive S-T, Shakespeare, William
 Oscar Wilde
Oscar Wilde
(1854 – 1900)
The Artist
One evening there came into his soul the desire to fashion an image of The Pleasure that abideth for a Moment. And he went forth into the world to look for bronze. For he could only think in bronze.
But all the bronze of the whole world had disappeared, nor anywhere in the whole world was there any bronze to be found, save only the bronze of the image of The Sorrow that endureth for Ever.
Now this image he had himself, and with his own hands, fashioned, and had set it on the tomb of the one thing he had loved in life. On the tomb of the dead thing he had most loved had he set this image of his own fashioning, that it might serve as a sign of the love of man that dieth not, and a symbol of the sorrow of man that endureth for ever. And in the whole world there was no other bronze save the bronze of this image.
And he took the image he had fashioned, and set it in a great furnace, and gave it to the fire.
And out of the bronze of the image of The Sorrow that endureth for Ever he fashioned an image of The Pleasure that abideth for a Moment.
Oscar Wilde, 1894
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive W-X, Wilde, Oscar, Wilde, Oscar

Het zijn er dertien. Natuurlijk. Want Tilburg. Dertien lichtvoetige dichters. Virtuoze taaltovenaars met gevoel voor humor. Nooit eerder kwamen zoveel gelauwerde woordkunstenaars in één voorstelling bijeen. Oude meesters als Ivo de Wijs, Pieter Nieuwint en Jan Boerstoel. Jong talent als Jan Beuving en Theo Danes. Verwacht verrassingen van alleskunner Erik van Muiswinkel, visuele ollekebollekes van Peter Knipmeijer en Frank Fabian van Keeren, hilarische liedjes van Dorine Wiersma en Roel C. Verburg. Zelfs Kees Torn stapt deze middag nog één keer op het podium. Kortom: deze unieke, eenmalige LichteGedichtenDag mag je gewoon niet missen.
De presentatie is in handen van Frank van Pamelen en Jan J. Pieterse. Dat maakt samen dertien dichters. Voor maar dertien euro. Natuurlijk. Want het is in Tilburg.
zondag 29 januari 2017 – 14:30u
Concertzaal Tilburg
LichteGedichtenDag
Ivo de Wijs, Kees Torn, Erik van Muiswinkel e.a.
cabaret – literair
# Meer informatie op website Theaters Tilburg
fleursdumal.nl magazine
More in: Art & Literature News, Frank van Pamelen, Ivo de Wijs, LIGHT VERSE, Literary Events, POETRY ARCHIVE, The talk of the town, THEATRE

Gertrude Stein
(1874-1946)
A Mounted Umbrella
What was the use of not leaving it there where it would hang what was the use if there was no chance of ever seeing it come there and show that it was handsome and right in the way it showed it. The lesson is to learn that it does show it, that it shows it and that nothing, that there is nothing, that there is no more to do about it and just so much more is there plenty of reason for making an exchange.
Gertrude Stein: A mounted umbrella
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive S-T, Stein, Gertrude

Rainer Maria Rilke
(1875 – 1926)
Départ
Mon amie, il faut que je parte.
Voulez-vous voir
l’endroit sur la carte?
C’est un point noir.
En moi, si la chose
bien me réussit,
ce sera un point rose
dans un vert pays.
Aus: Poèmes et Dédicaces (1920-1926)
Rainer Maria Rilke Gedichte
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive Q-R, Rilke, Rainer Maria

De Kunsthal Rotterdam presenteert het Locomotrutfantje, Moeder de Gans, Spartapiet, Cubaanse vlieg, Doorzager, Blauwwerker en meer beelden van Jules Deelder. Deelder, beter bekend als dichter en nachtburgemeester van Rotterdam, laat de poëzie van zijn verbeelding spreken. Zoals een echte dichter betaamt geeft hij zijn creaties de meest toepasselijke namen. In de tentoonstelling zijn elf unieke ‘Beelder’ te zien, gemaakt van kleurrijk plastic.
Sinds anderhalf jaar verzamelt J.A. Deelder pennen, cocktailstampertjes, injectiespuiten, pijpjes, rietjes, lepeltjes, tandenborstels, speelgoed en lensdopjes, om ze daarna op kleur te sorteren. Met lijm verwerkt Deelder al deze materialen tot driedimensionale objecten, waarmee hij een nieuwe dimensie aan zijn rijke oeuvre van poëzie en performances toevoegt. Hij zegt daar zelf over:
Je zit gewoon een beetje te klootzakke, en op een gegeven moment wordt het wat!
Jules Deelder
Ruimteschepen: Als Deelder’s dochter Ari in 2015 een film maakt over Willem Koopman alias Willem de wielrenner, vindt zij haar vader bereid een aantal ruimteschepen te maken zoals Willem altijd deed in de kroegen van Rotterdam. Koopman, een ex-wielrenner en voormalig zwerver met een bovennatuurlijke missie, zag Rotterdam als een ruimteschip dat elk moment uit het heelal geschoten kon worden. Deelder daarentegen ziet zijn creaties niet opstijgen tot in de verre uithoeken van het heelal, maar juist landen in de Kunsthal.
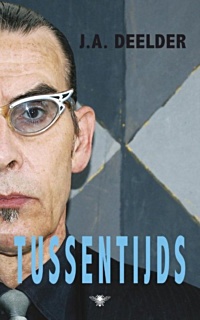 Over Jules Deelder: J.A. Deelder wordt in 1944 geboren als zoon van een Rotterdamse handelaar in vleeswaren. Sinds de vroege jaren zestig heeft Deelder nationale bekendheid als jazzconnaisseur, schrijver, dichter, performer en bovenal Rotterdammer. Zijn uitgesproken voorkeur voor zwarte kleding, vlinderbrillen, Sparta, Citroën en wielrennen maakt hem tot een graag geziene gast in tv- en radioprogramma’s.
Over Jules Deelder: J.A. Deelder wordt in 1944 geboren als zoon van een Rotterdamse handelaar in vleeswaren. Sinds de vroege jaren zestig heeft Deelder nationale bekendheid als jazzconnaisseur, schrijver, dichter, performer en bovenal Rotterdammer. Zijn uitgesproken voorkeur voor zwarte kleding, vlinderbrillen, Sparta, Citroën en wielrennen maakt hem tot een graag geziene gast in tv- en radioprogramma’s.
De Kunsthal Rotterdam is een van de toonaangevende culturele instellingen in Nederland, gelegen in het Museumpark in Rotterdam. Ontworpen door de beroemde architect Rem Koolhaas in 1992, biedt de Kunsthal zeven verschillende tentoonstellingsruimtes. Jaarlijks presenteert de Kunsthal een gevarieerd programma van circa 25 tentoonstellingen. Omdat er altijd meerdere tentoonstellingen tegelijk te bezichtigen zijn, biedt de Kunsthal een avontuurlijke reis door verschillende werelddelen en kunststromingen. Cultuur voor een breed publiek, van moderne meesters en hedendaagse kunst tot vergeten culturen, fotografie, mode en design. Bij de tentoonstellingen wordt een uitgebreid activiteitenprogramma georganiseerd.
Kunsthal Rotterdam
17 december 2016 tot 19 maart 2017
Dinsdag t/m zaterdag 10 — 17 uur
Zondag 11 — 17 uur
Museumpark
Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam
# Meer informatie op website Kunsthal Rotterdam
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive C-D, Archive C-D, Art & Literature News, AUDIO, CINEMA, RADIO & TV, DICTIONARY OF IDEAS, Exhibition Archive, Jules Deelder
 The Curse of Eve
The Curse of Eve
by Arthur Conan Doyle
Robert Johnson was an essentially commonplace man, with no feature to distinguish him from a million others. He was pale of face, ordinary in looks, neutral in opinions, thirty years of age, and a married man. By trade he was a gentleman’s outfitter in the New North Road, and the competition of business squeezed out of him the little character that was left. In his hope of conciliating customers he had become cringing and pliable, until working ever in the same routine from day to day he seemed to have sunk into a soulless machine rather than a man. No great question had ever stirred him. At the end of this snug century, self-contained in his own narrow circle, it seemed impossible that any of the mighty, primitive passions of mankind could ever reach him. Yet birth, and lust, and illness, and death are changeless things, and when one of these harsh facts springs out upon a man at some sudden turn of the path of life, it dashes off for the moment his mask of civilisation and gives a glimpse of the stranger and stronger face below.
Johnson’s wife was a quiet little woman, with brown hair and gentle ways. His affection for her was the one positive trait in his character. Together they would lay out the shop window every Monday morning, the spotless shirts in their green cardboard boxes below, the neckties above hung in rows over the brass rails, the cheap studs glistening from the white cards at either side, while in the background were the rows of cloth caps and the bank of boxes in which the more valuable hats were screened from the sunlight. She kept the books and sent out the bills. No one but she knew the joys and sorrows which crept into his small life. She had shared his exultations when the gentleman who was going to India had bought ten dozen shirts and an incredible number of collars, and she had been as stricken as he when, after the goods had gone, the bill was returned from the hotel address with the intimation that no such person had lodged there. For five years they had worked, building up the business, thrown together all the more closely because their marriage had been a childless one. Now, however, there were signs that a change was at hand, and that speedily. She was unable to come downstairs, and her mother, Mrs. Peyton, came over from Camberwell to nurse her and to welcome her grandchild.
Little qualms of anxiety came over Johnson as his wife’s time approached. However, after all, it was a natural process. Other men’s wives went through it unharmed, and why should not his? He was himself one of a family of fourteen, and yet his mother was alive and hearty. It was quite the exception for anything to go wrong. And yet in spite of his reasonings the remembrance of his wife’s condition was always like a sombre background to all his other thoughts.
Dr. Miles of Bridport Place, the best man in the neighbourhood, was retained five months in advance, and, as time stole on, many little packets of absurdly small white garments with frill work and ribbons began to arrive among the big consignments of male necessities. And then one evening, as Johnson was ticketing the scarfs in the shop, he heard a bustle upstairs, and Mrs. Peyton came running down to say that Lucy was bad and that she thought the doctor ought to be there without delay.
It was not Robert Johnson’s nature to hurry. He was prim and staid and liked to do things in an orderly fashion. It was a quarter of a mile from the corner of the New North Road where his shop stood to the doctor’s house in Bridport Place. There were no cabs in sight so he set off upon foot, leaving the lad to mind the shop. At Bridport Place he was told that the doctor had just gone to Harman Street to attend a man in a fit. Johnson started off for Harman Street, losing a little of his primness as he became more anxious. Two full cabs but no empty ones passed him on the way. At Harman Street he learned that the doctor had gone on to a case of measles, fortunately he had left the address—69 Dunstan Road, at the other side of the Regent’s Canal. Robert’s primness had vanished now as he thought of the women waiting at home, and he began to run as hard as he could down the Kingsland Road. Some way along he sprang into a cab which stood by the curb and drove to Dunstan Road. The doctor had just left, and Robert Johnson felt inclined to sit down upon the steps in despair.
Fortunately he had not sent the cab away, and he was soon back at Bridport Place. Dr. Miles had not returned yet, but they were expecting him every instant. Johnson waited, drumming his fingers on his knees, in a high, dim lit room, the air of which was charged with a faint, sickly smell of ether. The furniture was massive, and the books in the shelves were sombre, and a squat black clock ticked mournfully on the mantelpiece. It told him that it was half-past seven, and that he had been gone an hour and a quarter. Whatever would the women think of him! Every time that a distant door slammed he sprang from his chair in a quiver of eagerness. His ears strained to catch the deep notes of the doctor’s voice. And then, suddenly, with a gush of joy he heard a quick step outside, and the sharp click of the key in the lock. In an instant he was out in the hall, before the doctor’s foot was over the threshold.
“If you please, doctor, I’ve come for you,” he cried; “the wife was taken bad at six o’clock.”
He hardly knew what he expected the doctor to do. Something very energetic, certainly—to seize some drugs, perhaps, and rush excitedly with him through the gaslit streets. Instead of that Dr. Miles threw his umbrella into the rack, jerked off his hat with a somewhat peevish gesture, and pushed Johnson back into the room.
“Let’s see! You DID engage me, didn’t you?” he asked in no very cordial voice.
“Oh, yes, doctor, last November. Johnson the outfitter, you know, in the New North Road.”
“Yes, yes. It’s a bit overdue,” said the doctor, glancing at a list of names in a note-book with a very shiny cover. “Well, how is she?”
“I don’t——”
“Ah, of course, it’s your first. You’ll know more about it next time.”
“Mrs. Peyton said it was time you were there, sir.”
“My dear sir, there can be no very pressing hurry in a first case. We shall have an all-night affair, I fancy. You can’t get an engine to go without coals, Mr. Johnson, and I have had nothing but a light lunch.”
“We could have something cooked for you—something hot and a cup of tea.”
“Thank you, but I fancy my dinner is actually on the table. I can do no good in the earlier stages. Go home and say that I am coming, and I will be round immediately afterwards.”
A sort of horror filled Robert Johnson as he gazed at this man who could think about his dinner at such a moment. He had not imagination enough to realise that the experience which seemed so appallingly important to him, was the merest everyday matter of business to the medical man who could not have lived for a year had he not, amid the rush of work, remembered what was due to his own health. To Johnson he seemed little better than a monster. His thoughts were bitter as he sped back to his shop.
“You’ve taken your time,” said his mother-in-law reproachfully, looking down the stairs as he entered.
“I couldn’t help it!” he gasped. “Is it over?”
“Over! She’s got to be worse, poor dear, before she can be better. Where’s Dr. Miles!”
“He’s coming after he’s had dinner.” The old woman was about to make some reply, when, from the half-opened door behind a high whinnying voice cried out for her. She ran back and closed the door, while Johnson, sick at heart, turned into the shop. There he sent the lad home and busied himself frantically in putting up shutters and turning out boxes. When all was closed and finished he seated himself in the parlour behind the shop. But he could not sit still. He rose incessantly to walk a few paces and then fell back into a chair once more. Suddenly the clatter of china fell upon his ear, and he saw the maid pass the door with a cup on a tray and a smoking teapot.
“Who is that for, Jane?” he asked.
“For the mistress, Mr. Johnson. She says she would fancy it.”
There was immeasurable consolation to him in that homely cup of tea. It wasn’t so very bad after all if his wife could think of such things. So light-hearted was he that he asked for a cup also. He had just finished it when the doctor arrived, with a small black leather bag in his hand.
“Well, how is she?” he asked genially.
“Oh, she’s very much better,” said Johnson, with enthusiasm.
“Dear me, that’s bad!” said the doctor. “Perhaps it will do if I look in on my morning round?”
“No, no,” cried Johnson, clutching at his thick frieze overcoat. “We are so glad that you have come. And, doctor, please come down soon and let me know what you think about it.”
The doctor passed upstairs, his firm, heavy steps resounding through the house. Johnson could hear his boots creaking as he walked about the floor above him, and the sound was a consolation to him. It was crisp and decided, the tread of a man who had plenty of self-confidence. Presently, still straining his ears to catch what was going on, he heard the scraping of a chair as it was drawn along the floor, and a moment later he heard the door fly open and someone come rushing downstairs. Johnson sprang up with his hair bristling, thinking that some dreadful thing had occurred, but it was only his mother-in-law, incoherent with excitement and searching for scissors and some tape. She vanished again and Jane passed up the stairs with a pile of newly aired linen. Then, after an interval of silence, Johnson heard the heavy, creaking tread and the doctor came down into the parlour.
“That’s better,” said he, pausing with his hand upon the door. “You look pale, Mr. Johnson.”
“Oh no, sir, not at all,” he answered deprecatingly, mopping his brow with his handkerchief.
“There is no immediate cause for alarm,” said Dr. Miles. “The case is not all that we could wish it. Still we will hope for the best.”
“Is there danger, sir?” gasped Johnson.
“Well, there is always danger, of course. It is not altogether a favourable case, but still it might be much worse. I have given her a draught. I saw as I passed that they have been doing a little building opposite to you. It’s an improving quarter. The rents go higher and higher. You have a lease of your own little place, eh?”
“Yes, sir, yes!” cried Johnson, whose ears were straining for every sound from above, and who felt none the less that it was very soothing that the doctor should be able to chat so easily at such a time. “That’s to say no, sir, I am a yearly tenant.”
“Ah, I should get a lease if I were you. There’s Marshall, the watchmaker, down the street. I attended his wife twice and saw him through the typhoid when they took up the drains in Prince Street. I assure you his landlord sprung his rent nearly forty a year and he had to pay or clear out.”
“Did his wife get through it, doctor?”
“Oh yes, she did very well. Hullo! hullo!”
He slanted his ear to the ceiling with a questioning face, and then darted swiftly from the room.
It was March and the evenings were chill, so Jane had lit the fire, but the wind drove the smoke downwards and the air was full of its acrid taint. Johnson felt chilled to the bone, though rather by his apprehensions than by the weather. He crouched over the fire with his thin white hands held out to the blaze. At ten o’clock Jane brought in the joint of cold meat and laid his place for supper, but he could not bring himself to touch it. He drank a glass of the beer, however, and felt the better for it. The tension of his nerves seemed to have reacted upon his hearing, and he was able to follow the most trivial things in the room above. Once, when the beer was still heartening him, he nerved himself to creep on tiptoe up the stair and to listen to what was going on. The bedroom door was half an inch open, and through the slit he could catch a glimpse of the clean-shaven face of the doctor, looking wearier and more anxious than before. Then he rushed downstairs like a lunatic, and running to the door he tried to distract his thoughts by watching what; was going on in the street. The shops were all shut, and some rollicking boon companions came shouting along from the public-house. He stayed at the door until the stragglers had thinned down, and then came back to his seat by the fire. In his dim brain he was asking himself questions which had never intruded themselves before. Where was the justice of it? What had his sweet, innocent little wife done that she should be used so? Why was nature so cruel? He was frightened at his own thoughts, and yet wondered that they had never occurred to him before.
As the early morning drew in, Johnson, sick at heart and shivering in every limb, sat with his great coat huddled round him, staring at the grey ashes and waiting hopelessly for some relief. His face was white and clammy, and his nerves had been numbed into a half conscious state by the long monotony of misery. But suddenly all his feelings leapt into keen life again as he heard the bedroom door open and the doctor’s steps upon the stair. Robert Johnson was precise and unemotional in everyday life, but he almost shrieked now as he rushed forward to know if it were over.
One glance at the stern, drawn face which met him showed that it was no pleasant news which had sent the doctor downstairs. His appearance had altered as much as Johnson’s during the last few hours. His hair was on end, his face flushed, his forehead dotted with beads of perspiration. There was a peculiar fierceness in his eye, and about the lines of his mouth, a fighting look as befitted a man who for hours on end had been striving with the hungriest of foes for the most precious of prizes. But there was a sadness too, as though his grim opponent had been overmastering him. He sat down and leaned his head upon his hand like a man who is fagged out.
“I thought it my duty to see you, Mr. Johnson, and to tell you that it is a very nasty case. Your wife’s heart is not strong, and she has some symptoms which I do not like. What I wanted to say is that if you would like to have a second opinion I shall be very glad to meet anyone whom you might suggest.”
Johnson was so dazed by his want of sleep and the evil news that he could hardly grasp the doctor’s meaning. The other, seeing him hesitate, thought that he was considering the expense.
“Smith or Hawley would come for two guineas,” said he. “But I think Pritchard of the City Road is the best man.”
“Oh, yes, bring the best man,” cried Johnson.
“Pritchard would want three guineas. He is a senior man, you see.”
“I’d give him all I have if he would pull her through. Shall I run for him?”
“Yes. Go to my house first and ask for the green baize bag. The assistant will give it to you. Tell him I want the A. C. E. mixture. Her heart is too weak for chloroform. Then go for Pritchard and bring him back with you.”
It was heavenly for Johnson to have something to do and to feel that he was of some use to his wife. He ran swiftly to Bridport Place, his footfalls clattering through the silent streets and the big dark policemen turning their yellow funnels of light on him as he passed. Two tugs at the night-bell brought down a sleepy, half-clad assistant, who handed him a stoppered glass bottle and a cloth bag which contained something which clinked when you moved it. Johnson thrust the bottle into his pocket, seized the green bag, and pressing his hat firmly down ran as hard as he could set foot to ground until he was in the City Road and saw the name of Pritchard engraved in white upon a red ground. He bounded in triumph up the three steps which led to the door, and as he did so there was a crash behind him. His precious bottle was in fragments upon the pavement.
For a moment he felt as if it were his wife’s body that was lying there. But the run had freshened his wits and he saw that the mischief might be repaired. He pulled vigorously at the night-bell.
“Well, what’s the matter?” asked a gruff voice at his elbow. He started back and looked up at the windows, but there was no sign of life. He was approaching the bell again with the intention of pulling it, when a perfect roar burst from the wall.
“I can’t stand shivering here all night,” cried the voice. “Say who you are and what you want or I shut the tube.”
Then for the first time Johnson saw that the end of a speaking-tube hung out of the wall just above the bell. He shouted up it,—
“I want you to come with me to meet Dr. Miles at a confinement at once.”
“How far?” shrieked the irascible voice.
“The New North Road, Hoxton.”
“My consultation fee is three guineas, payable at the time.”
“All right,” shouted Johnson. “You are to bring a bottle of A. C. E. mixture with you.”
“All right! Wait a bit!”
Five minutes later an elderly, hard-faced man, with grizzled hair, flung open the door. As he emerged a voice from somewhere in the shadows cried,—
“Mind you take your cravat, John,” and he impatiently growled something over his shoulder in reply.
The consultant was a man who had been hardened by a life of ceaseless labour, and who had been driven, as so many others have been, by the needs of his own increasing family to set the commercial before the philanthropic side of his profession. Yet beneath his rough crust he was a man with a kindly heart.
“We don’t want to break a record,” said he, pulling up and panting after attempting to keep up with Johnson for five minutes. “I would go quicker if I could, my dear sir, and I quite sympathise with your anxiety, but really I can’t manage it.”
So Johnson, on fire with impatience, had to slow down until they reached the New North Road, when he ran ahead and had the door open for the doctor when he came. He heard the two meet outside the bed-room, and caught scraps of their conversation. “Sorry to knock you up—nasty case—decent people.” Then it sank into a mumble and the door closed behind them.
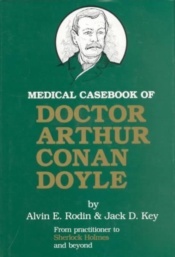 Johnson sat up in his chair now, listening keenly, for he knew that a crisis must be at hand. He heard the two doctors moving about, and was able to distinguish the step of Pritchard, which had a drag in it, from the clean, crisp sound of the other’s footfall. There was silence for a few minutes and then a curious drunken, mumbling sing-song voice came quavering up, very unlike anything which he had heard hitherto. At the same time a sweetish, insidious scent, imperceptible perhaps to any nerves less strained than his, crept down the stairs and penetrated into the room. The voice dwindled into a mere drone and finally sank away into silence, and Johnson gave a long sigh of relief, for he knew that the drug had done its work and that, come what might, there should be no more pain for the sufferer.
Johnson sat up in his chair now, listening keenly, for he knew that a crisis must be at hand. He heard the two doctors moving about, and was able to distinguish the step of Pritchard, which had a drag in it, from the clean, crisp sound of the other’s footfall. There was silence for a few minutes and then a curious drunken, mumbling sing-song voice came quavering up, very unlike anything which he had heard hitherto. At the same time a sweetish, insidious scent, imperceptible perhaps to any nerves less strained than his, crept down the stairs and penetrated into the room. The voice dwindled into a mere drone and finally sank away into silence, and Johnson gave a long sigh of relief, for he knew that the drug had done its work and that, come what might, there should be no more pain for the sufferer.
But soon the silence became even more trying to him than the cries had been. He had no clue now as to what was going on, and his mind swarmed with horrible possibilities. He rose and went to the bottom of the stairs again. He heard the clink of metal against metal, and the subdued murmur of the doctors’ voices. Then he heard Mrs. Peyton say something, in a tone as of fear or expostulation, and again the doctors murmured together. For twenty minutes he stood there leaning against the wall, listening to the occasional rumbles of talk without being able to catch a word of it. And then of a sudden there rose out of the silence the strangest little piping cry, and Mrs. Peyton screamed out in her delight and the man ran into the parlour and flung himself down upon the horse-hair sofa, drumming his heels on it in his ecstasy.
But often the great cat Fate lets us go only to clutch us again in a fiercer grip. As minute after minute passed and still no sound came from above save those thin, glutinous cries, Johnson cooled from his frenzy of joy, and lay breathless with his ears straining. They were moving slowly about. They were talking in subdued tones. Still minute after minute passing, and no word from the voice for which he listened. His nerves were dulled by his night of trouble, and he waited in limp wretchedness upon his sofa. There he still sat when the doctors came down to him—a bedraggled, miserable figure with his face grimy and his hair unkempt from his long vigil. He rose as they entered, bracing himself against the mantelpiece.
“Is she dead?” he asked.
“Doing well,” answered the doctor.
And at the words that little conventional spirit which had never known until that night the capacity for fierce agony which lay within it, learned for the second time that there were springs of joy also which it had never tapped before. His impulse was to fall upon his knees, but he was shy before the doctors.
“Can I go up?”
“In a few minutes.”
“I’m sure, doctor, I’m very—I’m very——” he grew inarticulate. “Here are your three guineas, Dr. Pritchard. I wish they were three hundred.”
“So do I,” said the senior man, and they laughed as they shook hands.
Johnson opened the shop door for them and heard their talk as they stood for an instant outside.
“Looked nasty at one time.”
“Very glad to have your help.”
“Delighted, I’m sure. Won’t you step round and have a cup of coffee?”
“No, thanks. I’m expecting another case.”
The firm step and the dragging one passed away to the right and the left. Johnson turned from the door still with that turmoil of joy in his heart. He seemed to be making a new start in life. He felt that he was a stronger and a deeper man. Perhaps all this suffering had an object then. It might prove to be a blessing both to his wife and to him. The very thought was one which he would have been incapable of conceiving twelve hours before. He was full of new emotions. If there had been a harrowing there had been a planting too.
“Can I come up?” he cried, and then, without waiting for an answer, he took the steps three at a time.
Mrs. Peyton was standing by a soapy bath with a bundle in her hands. From under the curve of a brown shawl there looked out at him the strangest little red face with crumpled features, moist, loose lips, and eyelids which quivered like a rabbit’s nostrils. The weak neck had let the head topple over, and it rested upon the shoulder.
“Kiss it, Robert!” cried the grandmother. “Kiss your son!”
But he felt a resentment to the little, red, blinking creature. He could not forgive it yet for that long night of misery. He caught sight of a white face in the bed and he ran towards it with such love and pity as his speech could find no words for.
“Thank God it is over! Lucy, dear, it was dreadful!”
“But I’m so happy now. I never was so happy in my life.”
Her eyes were fixed upon the brown bundle.
“You mustn’t talk,” said Mrs. Peyton.
“But don’t leave me,” whispered his wife.
So he sat in silence with his hand in hers. The lamp was burning dim and the first cold light of dawn was breaking through the window. The night had been long and dark but the day was the sweeter and the purer in consequence. London was waking up. The roar began to rise from the street. Lives had come and lives had gone, but the great machine was still working out its dim and tragic destiny.
Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930)
Round the Red Lamp: Being Facts and Fancies of Medical Life
The Curse of Eve (#06)
fleursdumal.nl magazine
More in: Doyle, Arthur Conan, Doyle, Arthur Conan, DRUGS & DISEASE & MEDICINE & LITERATURE, Round the Red Lamp

Alfred Lord Tennyson
(1809 – 1892)
Beauty
Oh, Beauty, passing beauty! sweetest Sweet!
How canst thou let me waste my youth in sighs;
I only ask to sit beside thy feet.
Thou knowest I dare not look into thine eyes,
Might I but kiss thy hand! I dare not fold
My arms about thee—scarcely dare to speak.
And nothing seems to me so wild and bold,
As with one kiss to touch thy blessèd cheek.
Methinks if I should kiss thee, no control
Within the thrilling brain could keep afloat
The subtle spirit. Even while I spoke,
The bare word KISS hath made my inner soul
To tremble like a lutestring, ere the note
Hath melted in the silence that it broke.
Alfred Lord Tennyson
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive S-T, Tennyson, Alfred Lord
Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature