Fleurs du Mal Magazine


Or see the index
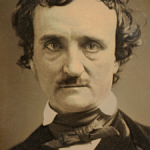
Edgar Allan Poe
The City in the Sea
Lo! Death has reared himself a throne
In a strange city lying alone
Far down within the dim West,
Where the good and the bad and the worst and the best
Have gone to their eternal rest.
There shrines and palaces and towers
(Time-eaten towers that tremble not!)
Resemble nothing that is ours.
Around, by lifting winds forgot,
Resignedly beneath the sky
The melancholy waters lie.
No rays from the holy heaven come down
On the long night-time of that town;
But light from out the lurid sea
Streams up the turrets silently
Gleams up the pinnacles far and free
Up domes up spires up kingly halls
Up fanes up Babylon-like walls
Up shadowy long-forgotten bowers
Of sculptured ivy and stone flowers
Up many and many a marvelous shrine
Whose wreathèd friezes intertwine
The viol, the violet, and the vine.
Resignedly beneath the sky
The melancholy waters lie.
So blend the turrets and shadows there
That all seem pendulous in air,
While from a proud tower in the town
Death looks gigantically down.
There open fanes and gaping graves
Yawn level with the luminous waves;
But not the riches there that lie
In each idol’s diamond eye
Not the gaily-jeweled dead
Tempt the waters from their bed;
For no ripples curl, alas!
Among that wilderness of glass
No swellings tell that winds may be
Upon some far-off happier sea
No heavings hint that winds have been
On seas less hideously serene.
But lo, a stir is in the air!
The wave there is a movement there!
As if the towers had thrust aside,
In slightly sinking, the dull tide
As if their tops had feebly given
A void within the filmy Heaven.
The waves have now a redder glow
The hours are breathing faint and low
And when, amid no earthly moans,
Down, down that town shall settle hence,
Hell, rising from a thousand thrones,
Shall do it reverence.
Edgar Allan Poe (1809 – 1849)
The City in the Sea
fleursdumal.nl magazine
More in: Edgar Allan Poe, Poe, Edgar Allan, Poe, Edgar Allan
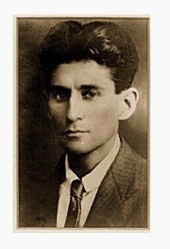 Franz Kafka
Franz Kafka
Brief an den Vater
Liebster Vater,
Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wußte Dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir habe, zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als daß ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. Und wenn ich hier versuche, Dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich Dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffs über mein Gedächtnis und meinen Verstand weit hinausgeht.
Dir hat sich die Sache immer sehr einfach dargestellt, wenigstens soweit Du vor mir und, ohne Auswahl, vor vielen andern davon gesprochen hast. Es schien Dir etwa so zu sein: Du hast Dein ganzes Leben lang schwer gearbeitet, alles für Deine Kinder, vor allem für mich geopfert, ich habe infolgedessen »in Saus und Braus« gelebt, habe vollständige Freiheit gehabt zu lernen was ich wollte, habe keinen Anlaß zu Nahrungssorgen, also zu Sorgen überhaupt gehabt; Du hast dafür keine Dankbarkeit verlangt, Du kennst »die Dankbarkeit der Kinder«, aber doch wenigstens irgendein Entgegenkommen, Zeichen eines Mitgefühls; statt dessen habe ich mich seit jeher vor Dir verkrochen, in mein Zimmer, zu Büchern, zu verrückten Freunden, zu überspannten Ideen; offen gesprochen habe ich mit Dir niemals, in den Tempel bin ich nicht zu Dir gekommen, in Franzensbad habe ich Dich nie besucht, auch sonst nie Familiensinn gehabt, um das Geschäft und Deine sonstigen Angelegenheiten habe ich mich nicht gekümmert, die Fabrik habe ich Dir aufgehalst und Dich dann verlassen, Ottla habe ich in ihrem Eigensinn unterstützt und während ich für Dich keinen Finger rühre (nicht einmal eine Theaterkarte bringe ich Dir), tue ich für Freunde alles. Faßt Du Dein Urteil über mich zusammen, so ergibt sich, daß Du mir zwar etwas geradezu Unanständiges oder Böses nicht vorwirfst (mit Ausnahme vielleicht meiner letzten Heiratsabsicht), aber Kälte, Fremdheit, Undankbarkeit. Und zwar wirfst Du es mir so vor, als wäre es meine Schuld, als hätte ich etwa mit einer Steuerdrehung das Ganze anders einrichten können, während Du nicht die geringste Schuld daran hast, es wäre denn die, daß Du zu gut zu mir gewesen bist.
Diese Deine übliche Darstellung halte ich nur so weit für richtig, daß auch ich glaube, Du seist gänzlich schuldlos an unserer Entfremdung. Aber ebenso gänzlich schuldlos bin auch ich. Könnte ich Dich dazu bringen, daß Du das anerkennst, dann wäre – nicht etwa ein neues Leben möglich, dazu sind wir beide viel zu alt, aber doch eine Art Friede, kein Aufhören, aber doch ein Mildern Deiner unaufhörlichen Vorwürfe.
Irgendeine Ahnung dessen, was ich sagen will, hast Du merkwürdigerweise. So hast Du mir zum Beispiel vor kurzem gesagt: »ich habe Dich immer gern gehabt, wenn ich auch äußerlich nicht so zu Dir war wie andere Väter zu sein pflegen, eben deshalb weil ich mich nicht verstellen kann wie andere«. Nun habe ich, Vater, im ganzen niemals an Deiner Güte mir gegenüber gezweifelt, aber diese Bemerkung halte ich für unrichtig. Du kannst Dich nicht verstellen, das ist richtig, aber nur aus diesem Grunde behaupten wollen, daß die andern Väter sich verstellen, ist entweder bloße, nicht weiter diskutierbare Rechthaberei oder aber – und das ist es meiner Meinung nach wirklich – der verhüllte Ausdruck dafür, daß zwischen uns etwas nicht in Ordnung ist und daß Du es mitverursacht hast, aber ohne Schuld. Meinst Du das wirklich, dann sind wir einig.
Ich sage ja natürlich nicht, daß ich das, was ich bin, nur durch Deine Einwirkung geworden bin. Das wäre sehr übertrieben (und ich neige sogar zu dieser Übertreibung). Es ist sehr leicht möglich, daß ich, selbst wenn ich ganz frei von Deinem Einfluß aufgewachsen wäre, doch kein Mensch nach Deinem Herzen hätte werden können. Ich wäre wahrscheinlich doch ein schwächlicher, ängstlicher, zögernder, unruhiger Mensch geworden, weder Robert Kafka noch Karl Hermann, aber doch ganz anders, als ich wirklich bin, und wir hätten uns ausgezeichnet miteinander vertragen können. Ich wäre glücklich gewesen, Dich als Freund, als Chef, als Onkel, als Großvater, ja selbst (wenn auch schon zögernder) als Schwiegervater zu haben. Nur eben als Vater warst Du zu stark für mich, besonders da meine Brüder klein starben, die Schwestern erst lange nachher kamen, ich also den ersten Stoß ganz allein aushalten mußte, dazu war ich viel zu schwach.
Vergleich uns beide: ich, um es sehr abgekürzt auszudrücken, ein Löwy mit einem gewissen Kafkaschen Fond, der aber eben nicht durch den Kafkaschen Lebens-, Geschäfts-, Eroberungswillen in Bewegung gesetzt wird, sondern durch einen Löwy’schen Stachel, der geheimer, scheuer, in anderer Richtung wirkt und oft überhaupt aussetzt. Du dagegen ein wirklicher Kafka an Stärke, Gesundheit, Appetit, Stimmkraft, Redebegabung, Selbstzufriedenheit, Weltüberlegenheit, Ausdauer, Geistesgegenwart, Menschenkenntnis, einer gewissen Großzügigkeit, natürlich auch mit allen zu diesen Vorzügen gehörigen Fehlern und Schwächen, in welche Dich Dein Temperament und manchmal Dein Jähzorn hineinhetzen. Nicht ganzer Kafka bist Du vielleicht in Deiner allgemeinen Weltansicht, soweit ich Dich mit Onkel Philipp, Ludwig, Heinrich vergleichen kann. Das ist merkwürdig, ich sehe hier auch nicht ganz klar. Sie waren doch alle fröhlicher, frischer, ungezwungener, leichtlebiger, weniger streng als Du. (Darin habe ich übrigens viel von Dir geerbt und das Erbe viel zu gut verwaltet, ohne allerdings die nötigen Gegengewichte in meinem Wesen zu haben, wie Du sie hast.) Doch hast auch andererseits Du in dieser Hinsicht verschiedene Zeiten durchgemacht, warst vielleicht fröhlicher, ehe Dich Deine Kinder, besonders ich, enttäuschten und zu Hause bedrückten (kamen Fremde, warst Du ja anders) und bist auch jetzt vielleicht wieder fröhlicher geworden, da Dir die Enkel und der Schwiegersohn wieder etwas von jener Wärme geben, die Dir die Kinder, bis auf Valli vielleicht, nicht geben konnten. Jedenfalls waren wir so verschieden und in dieser Verschiedenheit einander so gefährlich, daß, wenn man es hätte etwa im voraus ausrechnen wollen, wie ich, das langsam sich entwickelnde Kind, und Du, der fertige Mann, sich zueinander verhalten werden, man hätte annehmen können, daß Du mich einfach niederstampfen wirst, daß nichts von mir übrigbleibt. Das ist nun nicht geschehen, das Lebendige läßt sich nicht ausrechnen, aber vielleicht ist Ärgeres geschehen. Wobei ich Dich aber immerfort bitte, nicht zu vergessen, daß ich niemals im entferntesten an eine Schuld Deinerseits glaube. Du wirktest so auf mich, wie Du wirken mußtest, nur sollst Du aufhören, es für eine besondere Bosheit meinerseits zu halten, daß ich dieser Wirkung erlegen bin.
Ich war ein ängstliches Kind; trotzdem war ich gewiß auch störrisch, wie Kinder sind; gewiß verwöhnte mich die Mutter auch, aber ich kann nicht glauben, daß ich besonders schwer lenkbar war, ich kann nicht glauben, daß ein freundliches Wort, ein stilles Bei-der-Hand-Nehmen, ein guter Blick mir nicht alles hätten abfordern können, was man wollte. Nun bist Du ja im Grunde ein gütiger und weicher Mensch (das Folgende wird dem nicht widersprechen, ich rede ja nur von der Erscheinung, in der Du auf das Kind wirktest), aber nicht jedes Kind hat die Ausdauer und Unerschrockenheit, so lange zu suchen, bis es zu der Güte kommt. Du kannst ein Kind nur so behandeln, wie Du eben selbst geschaffen bist, mit Kraft, Lärm und Jähzorn, und in diesem Falle schien Dir das auch noch überdies deshalb sehr gut geeignet, weil Du einen kräftigen mutigen Jungen in mir aufziehen wolltest.
Deine Erziehungsmittel in den allerersten Jahren kann ich heute natürlich nicht unmittelbar beschreiben, aber ich kann sie mir etwa vorstellen durch Rückschluß aus den späteren Jahren und aus Deiner Behandlung des Felix. Hiebei kommt verschärfend in Betracht, daß Du damals jünger, daher frischer, wilder, ursprünglicher, noch unbekümmerter warst als heute und daß Du außerdem ganz an das Geschäft gebunden warst, kaum einmal des Tages Dich mir zeigen konntest und deshalb einen um so tieferen Eindruck auf mich machtest, der sich kaum je zur Gewöhnung verflachte.
Direkt erinnere ich mich nur an einen Vorfall aus den ersten Jahren. Du erinnerst Dich vielleicht auch daran. Ich winselte einmal in der Nacht immerfort um Wasser, gewiß nicht aus Durst, sondern wahrscheinlich teils um zu ärgern, teils um mich zu unterhalten. Nachdem einige starke Drohungen nicht geholfen hatten, nahmst Du mich aus dem Bett, trugst mich auf die Pawlatsche und ließest mich dort allein vor der geschlossenen Tür ein Weilchen im Hemd stehn. Ich will nicht sagen, daß das unrichtig war, vielleicht war damals die Nachtruhe auf andere Weise wirklich nicht zu verschaffen, ich will aber damit Deine Erziehungsmittel und ihre Wirkung auf mich charakterisieren. Ich war damals nachher wohl schon folgsam, aber ich hatte einen inneren Schaden davon. Das für mich Selbstverständliche des sinnlosen Ums-Wasser-Bittens und das außerordentlich Schreckliche des Hinausgetragenwerdens konnte ich meiner Natur nach niemals in die richtige Verbindung bringen. Noch nach Jahren litt ich unter der quälenden Vorstellung, daß der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz, fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Pawlatsche tragen konnte und daß ich also ein solches Nichts für ihn war.
Das war damals ein kleiner Anfang nur, aber dieses mich oft beherrschende Gefühl der Nichtigkeit (ein in anderer Hinsicht allerdings auch edles und fruchtbares Gefühl) stammt vielfach von Deinem Einfluß. Ich hätte ein wenig Aufmunterung, ein wenig Freundlichkeit, ein wenig Offenhalten meines Wegs gebraucht, statt dessen verstelltest Du mir ihn, in der guten Absicht freilich, daß ich einen anderen Weg gehen sollte. Aber dazu taugte ich nicht. Du muntertest mich zum Beispiel auf, wenn ich gut salutierte und marschierte, aber ich war kein künftiger Soldat, oder Du muntertest mich auf, wenn ich kräftig essen oder sogar Bier dazu trinken konnte, oder wenn ich unverstandene Lieder nachsingen oder Deine Lieblingsredensarten Dir nachplappern konnte, aber nichts davon gehörte zu meiner Zukunft. Und es ist bezeichnend, daß Du selbst heute mich nur dann eigentlich in etwas aufmunterst, wenn Du selbst in Mitleidenschaft gezogen bist, wenn es sich um Dein Selbstgefühl handelt, das ich verletze (zum Beispiel durch meine Heiratsabsicht) oder das in mir verletzt wird (wenn zum Beispiel Pepa mich beschimpft). Dann werde ich aufgemuntert, an meinen Wert erinnert, auf die Partien hingewiesen, die ich zu machen berechtigt wäre und Pepa wird vollständig verurteilt. Aber abgesehen davon, daß ich für Aufmunterung in meinem jetzigen Alter schon fast unzugänglich bin, was würde sie mir auch helfen, wenn sie nur dann eintritt, wo es nicht in erster Reihe um mich geht.
Damals und damals überall hätte ich die Aufmunterung gebraucht. Ich war ja schon niedergedrückt durch Deine bloße Körperlichkeit. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie wir uns öfters zusammen in einer Kabine auszogen. Ich mager, schwach, schmal, Du stark, groß, breit. Schon in der Kabine kam ich mir jämmerlich vor, und zwar nicht nur vor Dir, sondern vor der ganzen Welt, denn Du warst für mich das Maß aller Dinge. Traten wir dann aber aus der Kabine vor die Leute hinaus, ich an Deiner Hand, ein kleines Gerippe, unsicher, bloßfüßig auf den Planken, in Angst vor dem Wasser, unfähig Deine Schwimmbewegungen nachzumachen, die Du mir in guter Absicht, aber tatsächlich zu meiner tiefen Beschämung immerfort vormachtest, dann war ich sehr verzweifelt und alle meine schlimmen Erfahrungen auf allen Gebieten stimmten in solchen Augenblicken großartig zusammen. Am wohlsten war mir noch, wenn Du Dich manchmal zuerst auszogst und ich allein in der Kabine bleiben und die Schande des öffentlichen Auftretens so lange hinauszögern konnte, bis Du endlich nachschauen kamst und mich aus der Kabine triebst. Dankbar war ich Dir dafür, daß Du meine Not nicht zu bemerken schienest, auch war ich stolz auf den Körper meines Vaters. Übrigens besteht zwischen uns dieser Unterschied heute noch ähnlich.
Dem entsprach weiter Deine geistige Oberherrschaft. Du hattest Dich allein durch eigene Kraft so hoch hinaufgearbeitet, infolgedessen hattest Du unbeschränktes Vertrauen zu Deiner Meinung. Das war für mich als Kind nicht einmal so blendend wie später für den heranwachsenden jungen Menschen. In Deinem Lehnstuhl regiertest Du die Welt. Deine Meinung war richtig, jede andere war verrückt, überspannt, meschugge, nicht normal. Dabei war Dein Selbstvertrauen so groß, daß Du gar nicht konsequent sein mußtest und doch nicht aufhörtest recht zu haben. Es konnte auch vorkommen, daß Du in einer Sache gar keine Meinung hattest und infolgedessen alle Meinungen, die hinsichtlich der Sache überhaupt möglich waren, ohne Ausnahme falsch sein mußten. Du konntest zum Beispiel auf die Tschechen schimpfen, dann auf die Deutschen, dann auf die Juden, und zwar nicht nur in Auswahl, sondern in jeder Hinsicht, und schließlich blieb niemand mehr übrig außer Dir. Du bekamst für mich das Rätselhafte, das alle Tyrannen haben, deren Recht auf ihrer Person, nicht auf dem Denken begründet ist. Wenigstens schien es mir so.
Nun behieltest Du ja mir gegenüber tatsächlich erstaunlich oft recht, im Gespräch war das selbstverständlich, denn zum Gespräch kam es kaum, aber auch in Wirklichkeit. Doch war auch das nichts besonders Unbegreifliches: Ich stand ja in allem meinem Denken unter Deinem schweren Druck, auch in dem Denken, das nicht mit dem Deinen übereinstimmte und besonders in diesem. Alle diese von Dir scheinbar unabhängigen Gedanken waren von Anfang an belastet mit Deinem absprechenden Urteil; bis zur vollständigen und dauernden Ausführung des Gedankens das zu ertragen, war fast unmöglich. Ich rede hier nicht von irgendwelchen hohen Gedanken, sondern von jedem kleinen Unternehmen der Kinderzeit. Man mußte nur über irgendeine Sache glücklich sein, von ihr erfüllt sein, nach Hause kommen und es aussprechen und die Antwort war ein ironisches Seufzen, ein Kopfschütteln, ein Fingerklopfen auf den Tisch: »Hab auch schon etwas Schöneres gesehn« oder »Mir gesagt Deine Sorgen« oder »ich hab keinen so geruhten Kopf« oder »Kauf Dir was dafür!« oder »Auch ein Ereignis!« Natürlich konnte man nicht für jede Kinderkleinigkeit Begeisterung von Dir verlangen, wenn Du in Sorge und Plage lebtest. Darum handelte es sich auch nicht. Es handelte sich vielmehr darum, daß Du solche Enttäuschungen dem Kinde immer und grundsätzlich bereiten mußtest kraft Deines gegensätzlichen Wesens, weiter daß dieser Gegensatz durch Anhäufung des Materials sich unaufhörlich verstärkte, so daß er sich schließlich auch gewohnheitsmäßig geltend machte, wenn Du einmal der gleichen Meinung warst wie ich und daß endlich diese Enttäuschungen des Kindes nicht Enttäuschungen des gewöhnlichen Lebens waren, sondern, da es ja um Deine für alles maßgebende Person ging, im Kern trafen. Der Mut, die Entschlossenheit, die Zuversicht, die Freude an dem und jenem hielten nicht bis zum Ende aus, wenn Du dagegen warst oder schon wenn Deine Gegnerschaft bloß angenommen werden konnte; und angenommen konnte sie wohl bei fast allem werden, was ich tat.
Das bezog sich auf Gedanken so gut wie auf Menschen. Es genügte, daß ich an einem Menschen ein wenig Interesse hatte – es geschah ja infolge meines Wesens nicht sehr oft -, daß Du schon ohne jede Rücksicht auf mein Gefühl und ohne Achtung vor meinem Urteil mit Beschimpfung, Verleumdung, Entwürdigung dreinfuhrst. Unschuldige, kindliche Menschen wie zum Beispiel der jiddische Schauspieler Löwy mußten das büßen. Ohne ihn zu kennen, verglichst Du ihn in einer schrecklichen Weise, die ich schon vergessen habe, mit Ungeziefer, und wie so oft für Leute, die mir lieb waren, hattest Du automatisch das Sprichwort von den Hunden und Flöhen bei der Hand. An den Schauspieler erinnere ich mich hier besonders, weil ich Deine Aussprüche über ihn damals mir mit der Bemerkung notierte: »So spricht mein Vater über meinen Freund (den er gar nicht kennt) nur deshalb, weil er mein Freund ist. Das werde ich ihm immer entgegenhalten können, wenn er mir Mangel an kindlicher Liebe und Dankbarkeit vorwerfen wird.« Unverständlich war mir immer Deine vollständige Empfindungslosigkeit dafür, was für Leid und Schande Du mit Deinen Worten und Urteilen mir zufügen konntest, es war, als hättest Du keine Ahnung von Deiner Macht. Auch ich habe Dich sicher oft mit Worten gekränkt, aber dann wußte ich es immer, es schmerzte mich, aber ich konnte mich nicht beherrschen, das Wort nicht zurückhalten, ich bereute es schon, während ich es sagte. Du aber schlugst mit Deinen Worten ohneweiters los, niemand tat Dir leid, nicht währenddessen, nicht nachher, man war gegen Dich vollständig wehrlos.
Aber so war Deine ganze Erziehung. Du hast, glaube ich, ein Erziehungstalent; einem Menschen Deiner Art hättest Du durch Erziehung gewiß nützen können; er hätte die Vernünftigkeit dessen, was Du ihm sagtest, eingesehn, sich um nichts Weiteres gekümmert und die Sachen ruhig so ausgeführt. Für mich als Kind war aber alles, was Du mir zuriefst, geradezu Himmelsgebot, ich vergaß es nie, es blieb mir das wichtigste Mittel zur Beurteilung der Welt, vor allem zur Beurteilung Deiner selbst, und da versagtest Du vollständig. Da ich als Kind hauptsächlich beim Essen mit Dir beisammen war, war Dein Unterricht zum großen Teil Unterricht im richtigen Benehmen bei Tisch. Was auf den Tisch kam, mußte aufgegessen, über die Güte des Essens durfte nicht gesprochen werden – Du aber fandest das Essen oft ungenießbar; nanntest es »das Fressen« – das »Vieh« (die Köchin) hatte es verdorben. Weil Du entsprechend Deinem kräftigen Hunger und Deiner besonderen Vorliebe alles schnell, heiß und in großen Bissen gegessen hast, mußte sich das Kind beeilen, düstere Stille war bei Tisch, unterbrochen von Ermahnungen: »zuerst iß, dann sprich« oder »schneller, schneller, schneller« oder »siehst Du, ich habe schon längst aufgegessen«. Knochen durfte man nicht zerreißen, Du ja. Essig durfte man nicht schlürfen, Du ja. Die Hauptsache war, daß man das Brot gerade schnitt; daß Du das aber mit einem von Sauce triefenden Messer tatest, war gleichgültig. Man mußte achtgeben, daß keine Speisereste auf den Boden fielen, unter Dir lag schließlich am meisten. Bei Tisch durfte man sich nur mit Essen beschäftigen, Du aber putztest und schnittest Dir die Nägel, spitztest Bleistifte, reinigtest mit dem Zahnstocher die Ohren. Bitte, Vater, verstehe mich recht, das wären an sich vollständig unbedeutende Einzelheiten gewesen, niederdrückend wurden sie für mich erst dadurch, daß Du, der für mich so ungeheuer maßgebende Mensch, Dich selbst an die Gebote nicht hieltest, die Du mir auferlegtest. Dadurch wurde die Welt für mich in drei Teile geteilt, in einen, wo ich, der Sklave, lebte, unter Gesetzen, die nur für mich erfunden waren und denen ich überdies, ich wußte nicht warum, niemals völlig entsprechen konnte, dann in eine zweite Welt, die unendlich von meiner entfernt war, in der Du lebtest, beschäftigt mit der Regierung, mit dem Ausgeben der Befehle und mit dem Ärger wegen deren Nichtbefolgung, und schließlich in eine dritte Welt, wo die übrigen Leute glücklich und frei von Befehlen und Gehorchen lebten. Ich war immerfort in Schande, entweder befolgte ich Deine Befehle, das war Schande, denn sie galten ja nur für mich; oder ich war trotzig, das war auch Schande, denn wie durfte ich Dir gegenüber trotzig sein, oder ich konnte nicht folgen, weil ich zum Beispiel nicht Deine Kraft, nicht Deinen Appetit, nicht Deine Geschicklichkeit hatte, trotzdem Du es als etwas Selbstverständliches von mir verlangtest; das war allerdings die größte Schande. In dieser Weise bewegten sich nicht die Überlegungen, aber das Gefühl des Kindes.
Meine damalige Lage wird vielleicht deutlicher, wenn ich sie mit der von Felix vergleiche. Auch ihn behandelst Du ja ähnlich, ja wendest sogar ein besonders fürchterliches Erziehungsmittel gegen ihn an, indem Du, wenn er beim Essen etwas Deiner Meinung nach Unreines macht, Dich nicht damit begnügst, wie damals zu mir zu sagen: »Du bist ein großes Schwein«, sondern noch hinzufügst: »ein echter Hermann« oder »genau, wie Dein Vater«. Nun schadet das aber vielleicht – mehr als »vielleicht« kann man nicht sagen – dem Felix wirklich nicht wesentlich, denn für ihn bist Du eben nur ein allerdings besonders bedeutender Großvater, aber doch nicht alles, wie Du es für mich gewesen bist, außerdem ist Felix ein ruhiger, schon jetzt gewissermaßen männlicher Charakter, der sich durch eine Donnerstimme vielleicht verblüffen, aber nicht für die Dauer bestimmen läßt, vor allem aber ist er doch nur verhältnismäßig selten mit Dir beisammen, steht ja auch unter anderen Einflüssen, Du bist ihm mehr etwas liebes Kurioses, aus dem er auswählen kann, was er sich nehmen will. Mir warst Du nichts Kurioses, ich konnte nicht auswählen, ich mußte alles nehmen.
Und zwar ohne etwas dagegen vorbringen zu können, denn es ist Dir von vornherein nicht möglich, ruhig über eine Sache zu sprechen, mit der Du nicht einverstanden bist oder die bloß nicht von Dir ausgeht; Dein herrisches Temperament läßt das nicht zu. In den letzten Jahren erklärst Du das durch Deine Herznervosität, ich wüßte nicht, daß Du jemals wesentlich anders gewesen bist, höchstens ist Dir die Herznervosität ein Mittel zur strengeren Ausübung der Herrschaft, da der Gedanke daran die letzte Widerrede im anderen ersticken muß. Das ist natürlich kein Vorwurf, nur Feststellung einer Tatsache. Etwa bei Ottla: »Man kann ja mit ihr gar nicht sprechen, sie springt einem gleich ins Gesicht«, pflegst Du zu sagen, aber in Wirklichkeit springt sie ursprünglich gar nicht; Du verwechselst die Sache mit der Person; die Sache springt Dir ins Gesicht, und Du entscheidest sie sofort ohne Anhören der Person; was nachher noch vorgebracht wird, kann Dich nur weiter reizen, niemals überzeugen. Dann hört man von Dir nur noch: »Mach, was Du willst; von mir aus bist Du frei; Du bist großjährig; ich habe Dir keine Ratschläge zu geben«, und alles das mit dem fürchterlichen heiseren Unterton des Zornes und der vollständigen Verurteilung, vor dem ich heute nur deshalb weniger zittere als in der Kinderzeit, weil das ausschließliche Schuldgefühl des Kindes zum Teil ersetzt ist durch den Einblick in unser beider Hilflosigkeit.
Die Unmöglichkeit des ruhigen Verkehrs hatte noch eine weitere eigentlich sehr natürliche Folge: ich verlernte das Reden. Ich wäre ja wohl auch sonst kein großer Redner geworden, aber die gewöhnlich fließende menschliche Sprache hätte ich doch beherrscht. Du hast mir aber schon früh das Wort verboten. Deine Drohung: »kein Wort der Widerrede!« und die dazu erhobene Hand begleiten mich schon seit jeher. Ich bekam vor Dir – Du bist, sobald es um Deine Dinge geht, ein ausgezeichneter Redner – eine stockende, stotternde Art des Sprechens, auch das war Dir noch zu viel, schließlich schwieg ich, zuerst vielleicht aus Trotz, dann, weil ich vor Dir weder denken noch reden konnte. Und weil Du mein eigentlicher Erzieher warst, wirkte das überall in meinem Leben nach. Es ist überhaupt ein merkwürdiger Irrtum, wenn Du glaubst, ich hätte mich Dir nie gefügt. »Immer alles contra« ist wirklich nicht mein Lebensgrundsatz Dir gegenüber gewesen, wie Du glaubst und mir vorwirfst. Im Gegenteil: hätte ich Dir weniger gefolgt, Du wärest sicher viel zufriedener mit mir. Vielmehr haben alle Deine Erziehungsmaßnahmen genau getroffen; keinem Griff bin ich ausgewichen; so wie ich bin, bin ich (von den Grundlagen und der Einwirkung des Lebens natürlich abgesehen) das Ergebnis Deiner Erziehung und meiner Folgsamkeit. Daß dieses Ergebnis Dir trotzdem peinlich ist, ja daß Du Dich unbewußt weigerst, es als Dein Erziehungsergebnis anzuerkennen, liegt eben daran, daß Deine Hand und mein Material einander so fremd gewesen sind. Du sagtest: »Kein Wort der Widerrede!« und wolltest damit die Dir unangenehmen Gegenkräfte in mir zum Schweigen bringen, diese Einwirkung war aber für mich zu stark, ich war zu folgsam, ich verstummte gänzlich, verkroch mich vor Dir und wagte mich erst zu regen, wenn ich so weit von Dir entfernt war, daß Deine Macht, wenigstens direkt, nicht mehr hinreichte. Du aber standst davor, und alles schien Dir wieder »contra« zu sein, während es nur selbstverständliche Folge Deiner Stärke und meiner Schwäche war.
Deine äußerst wirkungsvollen, wenigstens mir gegenüber niemals versagenden rednerischen Mittel bei der Erziehung waren: Schimpfen, Drohen, Ironie, böses Lachen und – merkwürdigerweise – Selbstbeklagung.
Daß Du mich direkt und mit ausdrücklichen Schimpfwörtern beschimpft hättest, kann ich mich nicht erinnern. Es war auch nicht nötig, Du hattest so viele andere Mittel, auch flogen im Gespräch zu Hause und besonders im Geschäft die Schimpfwörter rings um mich in solchen Mengen auf andere nieder, daß ich als kleiner Junge manchmal davon fast betäubt war und keinen Grund hatte, sie nicht auch auf mich zu beziehen, denn die Leute, die Du beschimpftest, waren gewiß nicht schlechter als ich, und Du warst gewiß mit ihnen nicht unzufriedener als mit mir. Und auch hier war wieder Deine rätselhafte Unschuld und Unangreifbarkeit, Du schimpftest, ohne Dir irgendwelche Bedenken deshalb zu machen, ja Du verurteiltest das Schimpfen bei anderen und verbotest es.
Das Schimpfen verstärktest Du mit Drohen, und das galt nun auch schon mir. Schrecklich war mir zum Beispiel dieses: »ich zerreiße Dich wie einen Fisch«, trotzdem ich ja wußte, daß dem nichts Schlimmeres nachfolgte (als kleines Kind wußte ich das allerdings nicht), aber es entsprach fast meinen Vorstellungen von Deiner Macht, daß Du auch das imstande gewesen wärest. Schrecklich war es auch, wenn Du schreiend um den Tisch herumliefst, um einen zu fassen, offenbar gar nicht fassen wolltest, aber doch so tatest und die Mutter einen schließlich scheinbar rettete. Wieder hatte man einmal, so schien es dem Kind, das Leben durch Deine Gnade behalten und trug es als Dein unverdientes Geschenk weiter. Hierher gehören auch die Drohungen wegen der Folgen des Ungehorsams. Wenn ich etwas zu tun anfing, was Dir nicht gefiel, und Du drohtest mir mit dem Mißerfolg, so war die Ehrfurcht vor Deiner Meinung so groß, daß damit der Mißerfolg, wenn auch vielleicht erst für eine spätere Zeit, unaufhaltsam war. Ich verlor das Vertrauen zu eigenem Tun. Ich war unbeständig, zweifelhaft. Je älter ich wurde, desto größer war das Material, das Du mir zum Beweis meiner Wertlosigkeit entgegenhalten konntest; allmählich bekamst Du in gewisser Hinsicht wirklich recht. Wieder hüte ich mich zu behaupten, daß ich nur durch Dich so wurde; Du verstärktest nur, was war, aber Du verstärktest es sehr, weil Du eben mir gegenüber sehr mächtig warst und alle Macht dazu verwendetest.
Ein besonderes Vertrauen hattest Du zur Erziehung durch Ironie, sie entsprach auch am besten Deiner Überlegenheit über mich. Eine Ermahnung hatte bei Dir gewöhnlich diese Form: »Kannst Du das nicht so und so machen? Das ist Dir wohl schon zu viel? Dazu hast Du natürlich keine Zeit?« und ähnlich. Dabei jede solche Frage begleitet von bösem Lachen und bösem Gesicht. Man wurde gewissermaßen schon bestraft, ehe man noch wußte, daß man etwas Schlechtes getan hatte. Aufreizend waren auch jene Zurechtweisungen, wo man als dritte Person behandelt, also nicht einmal des bösen Ansprechens gewürdigt wurde; wo Du also etwa formell zur Mutter sprachst, aber eigentlich zu mir, der dabei saß, zum Beispiel: »Das kann man vom Herrn Sohn natürlich nicht haben« und dergleichen. (Das bekam dann sein Gegenspiel darin, daß ich zum Beispiel nicht wagte und später aus Gewohnheit gar nicht mehr daran dachte, Dich direkt zu fragen, wenn die Mutter dabei war. Es war dem Kind viel ungefährlicher, die neben Dir sitzende Mutter nach Dir auszufragen, man fragte dann die Mutter: »Wie geht es dem Vater?« und sicherte sich so vor Überraschungen.) Es gab natürlich auch Fälle, wo man mit der ärgsten Ironie sehr einverstanden war, nämlich wenn sie einen anderen betraf, zum Beispiel die Elli, mit der ich jahrelang böse war. Es war für mich ein Fest der Bosheit und Schadenfreude, wenn es von ihr fast bei jedem Essen etwa hieß: »Zehn Meter weit vom Tisch muß sie sitzen, die breite Mad« und wenn Du dann böse auf Deinem Sessel, ohne die leiseste Spur von Freundlichkeit oder Laune, sondern als erbitterter Feind übertrieben ihr nachzumachen suchtest, wie äußerst widerlich für Deinen Geschmack sie dasaß. Wie oft hat sich das und ähnliches wiederholen müssen, wie wenig hast Du im Tatsächlichen dadurch erreicht. Ich glaube, es lag daran, daß der Aufwand von Zorn und Bösesein zur Sache selbst in keinem richtigen Verhältnis zu sein schien, man hatte nicht das Gefühl, daß der Zorn durch diese Kleinigkeit des Weit-vom-Tische-Sitzens erzeugt sei, sondern daß er in seiner ganzen Größe von vornherein vorhanden war und nur zufällig gerade diese Sache als Anlaß zum Losbrechen genommen habe. Da man überzeugt war, daß sich ein Anlaß jedenfalls finden würde, nahm man sich nicht besonders zusammen, auch stumpfte man unter der fortwährenden Drohung ab; daß man nicht geprügelt wurde, dessen war man ja allmählich fast sicher. Man wurde ein mürrisches, unaufmerksames, ungehorsames Kind, immer auf eine Flucht, meist eine innere, bedacht. So littest Du, so litten wir. Du hattest von Deinem Standpunkt ganz recht, wenn Du mit zusammengebissenen Zähnen und dem gurgelnden Lachen, welches dem Kind zum erstenmal höllische Vorstellungen vermittelt hatte, bitter zu sagen pflegtest (wie erst letzthin wegen eines Konstantinopler Briefes): »Das ist eine Gesellschaft!«
Ganz unverträglich mit dieser Stellung zu Deinen Kindern schien es zu sein, wenn Du, was ja sehr oft geschah, öffentlich Dich beklagtest. Ich gestehe, daß ich als Kind (später wohl) dafür gar kein Gefühl hatte und nicht verstand, wie Du überhaupt erwarten konntest, Mitgefühl zu finden. Du warst so riesenhaft in jeder Hinsicht; was konnte Dir an unserem Mitleid liegen oder gar an unserer Hilfe? Die mußtest Du doch eigentlich verachten, wie uns selbst so oft. Ich glaubte daher den Klagen nicht und suchte irgendeine geheime Absicht hinter ihnen. Erst später begriff ich, daß Du wirklich durch die Kinder sehr littest, damals aber, wo die Klagen noch unter anderen Umständen einen kindlichen, offenen, bedenkenlosen, zu jeder Hilfe bereiten Sinn hätten antreffen können, mußten sie mir wieder nur überdeutliche Erziehungs- und Demütigungsmittel sein, als solche an sich nicht sehr stark, aber mit der schädlichen Nebenwirkung, daß das Kind sich gewöhnte, gerade Dinge nicht sehr ernst zu nehmen, die es ernst hätte nehmen sollen.
Es gab glücklicherweise davon allerdings auch Ausnahmen, meistens wenn Du schweigend littest und Liebe und Güte mit ihrer Kraft alles Entgegenstehende überwand und unmittelbar ergriff. Selten war das allerdings, aber es war wunderbar. Etwa wenn ich Dich früher in heißen Sommern mittags nach dem Essen im Geschäft müde ein wenig schlafen sah, den Ellbogen auf dem Pult, oder wenn Du sonntags abgehetzt zu uns in die Sommerfrische kamst; oder wenn Du bei einer schweren Krankheit der Mutter zitternd vom Weinen Dich am Bücherkasten festhieltest; oder wenn Du während meiner letzten Krankheit leise zu mir in Ottlas Zimmer kamst, auf der Schwelle bliebst, nur den Hals strecktest, um mich im Bett zu sehn, und aus Rücksicht nur mit der Hand grüßtest. Zu solchen Zeiten legte man sich hin und weinte vor Glück und weint jetzt wieder, während man es schreibt.
Du hast auch eine besonders schöne, sehr selten zu sehende Art eines stillen, zufriedenen, gutheißenden Lächelns, das den, dem es gilt, ganz glücklich machen kann. Ich kann mich nicht erinnern, daß es in meiner Kindheit ausdrücklich mir zuteil geworden wäre, aber es dürfte wohl geschehen sein, denn warum solltest Du es mir damals verweigert haben, da ich Dir noch unschuldig schien und Deine große Hoffnung war. Übrigens haben auch solche freundliche Eindrücke auf die Dauer nichts anderes erzielt, als mein Schuldbewußtsein vergrößert und die Welt mir noch unverständlicher gemacht.
Lieber hielt ich mich ans Tatsächliche und Fortwährende. Um mich Dir gegenüber nur ein wenig zu behaupten, zum Teil auch aus einer Art Rache, fing ich bald an, kleine Lächerlichkeiten, die ich an Dir bemerkte, zu beobachten, zu sammeln, zu übertreiben. Wie Du zum Beispiel leicht Dich von meist nur scheinbar höherstehenden Personen blenden ließest und davon immerfort erzählen konntest, etwa von irgendeinem kaiserlichen Rat oder dergleichen (andererseits tat mir etwas Derartiges auch weh, daß Du, mein Vater, solche nichtige Bestätigungen Deines Wertes zu brauchen glaubtest und mit ihnen großtätest). Oder ich beobachtete Deine Vorliebe für unanständige, möglichst laut herausgebrachte Redensarten, über die Du lachtest, als hättest Du etwas besonders Vortreffliches gesagt, während es eben nur eine platte, kleine Unanständigkeit war (gleichzeitig war es allerdings auch wieder eine mich beschämende Äußerung Deiner Lebenskraft). Solcher verschiedener Beobachtungen gab es natürlich eine Menge; ich war glücklich über sie, es gab für mich Anlaß zu Getuschel und Spaß, Du bemerktest es manchmal, ärgertest Dich darüber, hieltest es für Bosheit, Respektlosigkeit, aber glaube mir, es war nichts anderes für mich als ein übrigens untaugliches Mittel zur Selbsterhaltung, es waren Scherze, wie man sie über Götter und Könige verbreitet, Scherze, die mit dem tiefsten Respekt nicht nur sich verbinden lassen, sondern sogar zu ihm gehören.
Auch Du hast übrigens, entsprechend Deiner ähnlichen Lage mir gegenüber, eine Art Gegenwehr versucht. Du pflegtest darauf hinzuweisen, wie übertrieben gut es mir ging und wie gut ich eigentlich behandelt worden bin. Das ist richtig, ich glaube aber nicht, daß es mir unter den einmal vorhandenen Umständen im wesentlichen genützt hat.
Es ist wahr, daß die Mutter grenzenlos gut zu mir war, aber alles das stand für mich in Beziehung zu Dir, also in keiner guten Beziehung. Die Mutter hatte unbewußt die Rolle eines Treibers in der Jagd. Wenn schon Deine Erziehung in irgendeinem unwahrscheinlichen Fall mich durch Erzeugung von Trotz, Abneigung oder gar Haß auf eigene Füße hätte stellen können, so glich das die Mutter durch Gutsein, durch vernünftige Rede (sie war im Wirrwarr der Kindheit das Urbild der Vernunft), durch Fürbitte wieder aus, und ich war wieder in Deinen Kreis zurückgetrieben, aus dem ich sonst vielleicht, Dir und mir zum Vorteil, ausgebrochen wäre. Oder es war so, daß es zu keiner eigentlichen Versöhnung kam, daß die Mutter mich vor Dir bloß im Geheimen schützte, mir im Geheimen etwas gab, etwas erlaubte, dann war ich wieder vor Dir das lichtscheue Wesen, der Betrüger, der Schuldbewußte, der wegen seiner Nichtigkeit selbst zu dem, was er für sein Recht hielt, nur auf Schleichwegen kommen konnte. Natürlich gewöhnte ich mich dann, auf diesen Wegen auch das zu suchen, worauf ich, selbst meiner Meinung nach, kein Recht hatte. Das war wieder Vergrößerung des Schuldbewußtseins.
Es ist auch wahr, daß Du mich kaum einmal wirklich geschlagen hast. Aber das Schreien, das Rotwerden Deines Gesichts, das eilige Losmachen der Hosenträger, ihr Bereitliegen auf der Stuhllehne, war für mich fast ärger. Es ist, wie wenn einer gehängt werden soll. Wird er wirklich gehenkt, dann ist er tot und es ist alles vorüber. Wenn er aber alle Vorbereitungen zum Gehenktwerden miterleben muß und erst wenn ihm die Schlinge vor dem Gesicht hängt, von seiner Begnadigung erfährt, so kann er sein Leben lang daran zu leiden haben. Überdies sammelte sich aus diesen vielen Malen, wo ich Deiner deutlich gezeigten Meinung nach Prügel verdient hätte, ihnen aber aus Deiner Gnade noch knapp entgangen war, wieder nur ein großes Schuldbewußtsein an. Von allen Seiten her kam ich in Deine Schuld.
Seit jeher machtest Du mir zum Vorwurf (und zwar mir allein oder vor anderen, für das Demütigende des letzteren hattest Du kein Gefühl, die Angelegenheiten Deiner Kinder waren immer öffentliche), daß ich dank Deiner Arbeit ohne alle Entbehrungen in Ruhe, Wärme, Fülle lebte. Ich denke da an Bemerkungen, die in meinem Gehirn förmlich Furchen gezogen haben müssen, wie: »Schon mit sieben Jahren mußte ich mit dem Karren durch die Dörfer fahren.« »Wir mußten alle in einer Stube schlafen.« »Wir waren glücklich, wenn wir Erdäpfel hatten.« »Jahrelang hatte ich wegen ungenügender Winterkleidung offene Wunden an den Beinen.« »Als kleiner Junge mußte ich schon nach Pisek ins Geschäft.« »Von zuhause bekam ich gar nichts, nicht einmal beim Militär, ich schickte noch Geld nachhause.« »Aber trotzdem, trotzdem – der Vater war mir immer der Vater. Wer weiß das heute! Was wissen die Kinder! Das hat niemand gelitten! Versteht das heute ein Kind?« Solche Erzählungen hätten unter anderen Verhältnissen ein ausgezeichnetes Erziehungsmittel sein können, sie hätten zum Überstehen der gleichen Plagen und Entbehrungen, die der Vater durchgemacht hatte, aufmuntern und kräftigen können. Aber das wolltest Du doch gar nicht, die Lage war ja eben durch das Ergebnis Deiner Mühe eine andere geworden, Gelegenheit, sich in der Weise auszuzeichnen, wie Du es getan hattest, gab es nicht. Eine solche Gelegenheit hätte man erst durch Gewalt und Umsturz schaffen müssen, man hätte von zu Hause ausbrechen müssen (vorausgesetzt, daß man die Entschlußfähigkeit und Kraft dazu gehabt hätte und die Mutter nicht ihrerseits mit anderen Mitteln dagegen gearbeitet hätte). Aber das alles wolltest Du doch gar nicht, das bezeichnetest Du als Undankbarkeit, Überspanntheit, Ungehorsam, Verrat, Verrücktheit. Während Du also von einer Seite durch Beispiel, Erzählung und Beschämung dazu locktest, verbotest Du es auf der anderen Seite allerstrengstens. Sonst hättest Du zum Beispiel, von den Nebenumständen abgesehen, von Ottlas Zürauer Abenteuer eigentlich entzückt sein müssen. Sie wollte auf das Land, von dem Du gekommen warst, sie wollte Arbeit und Entbehrungen haben, wie Du sie gehabt hattest, sie wollte nicht Deine Arbeitserfolge genießen, wie auch Du von Deinem Vater unabhängig gewesen bist. Waren das so schreckliche Absichten? So fern Deinem Beispiel und Deiner Lehre? Gut, die Absichten Ottlas mißlangen schließlich im Ergebnis, wurden vielleicht etwas lächerlich, mit zuviel Lärm ausgeführt, sie nahm nicht genug Rücksicht auf ihre Eltern. War das aber ausschließlich ihre Schuld, nicht auch die Schuld der Verhältnisse und vor allem dessen, daß Du ihr so entfremdet warst? War sie Dir etwa (wie Du Dir später selbst einreden wolltest) im Geschäft weniger entfremdet, als nachher in Zürau? Und hättest Du nicht ganz gewiß die Macht gehabt (vorausgesetzt, daß Du Dich dazu hättest überwinden können), durch Aufmunterung, Rat und Aufsicht, vielleicht sogar nur durch Duldung aus diesem Abenteuer etwas sehr Gutes zu machen?
Anschließend an solche Erfahrungen pflegtest Du in bitterem Scherz zu sagen, daß es uns zu gut ging. Aber dieser Scherz ist in gewissem Sinn keiner. Das, was Du Dir erkämpfen mußtest, bekamen wir aus Deiner Hand, aber den Kampf um das äußere Leben, der Dir sofort zugänglich war und der natürlich auch uns nicht erspart bleibt, den müssen wir uns erst spät, mit Kinderkraft im Mannesalter erkämpfen. Ich sage nicht, daß unsere Lage deshalb unbedingt ungünstiger ist als es Deine war, sie ist jener vielmehr wahrscheinlich gleichwertig – (wobei allerdings die Grundanlagen nicht verglichen sind), nur darin sind wir im Nachteil, daß wir mit unserer Not uns nicht rühmen und niemanden mit ihr demütigen können, wie Du es mit Deiner Not getan hast. Ich leugne auch nicht, daß es möglich gewesen wäre, daß ich die Früchte Deiner großen und erfolgreichen Arbeit wirklich richtig hätte genießen, verwerten und mit ihnen zu Deiner Freude hätte weiterarbeiten können, dem aber stand eben unsere Entfremdung entgegen. Ich konnte, was Du gabst, genießen, aber nur in Beschämung, Müdigkeit, Schwäche, Schuldbewußtsein. Deshalb konnte ich Dir für alles nur bettlerhaft dankbar sein, durch die Tat nicht.
Das nächste äußere Ergebnis dieser ganzen Erziehung war, daß ich alles floh, was nur von der Ferne an Dich erinnerte. Zuerst das Geschäft. An und für sich besonders in der Kinderzeit, solange es ein Gassengeschäft war, hätte es mich sehr freuen müssen, es war so lebendig, abends beleuchtet, man sah, man hörte viel, konnte hie und da helfen, sich auszeichnen, vor allem aber Dich bewundern in Deinen großartigen kaufmännischen Talenten, wie Du verkauftest, Leute behandeltest, Späße machtest, unermüdlich warst, in Zweifelsfällen sofort die Entscheidung wußtest und so weiter; noch wie Du einpacktest oder eine Kiste aufmachtest, war ein sehenswertes Schauspiel und das Ganze alles in allem gewiß nicht die schlechteste Kinderschule. Aber da Du allmählich von allen Seiten mich erschrecktest und Geschäft und Du sich mir deckten, war mir auch das Geschäft nicht mehr behaglich. Dinge, die mir dort zuerst selbstverständlich gewesen waren, quälten, beschämten mich, besonders Deine Behandlung des Personals. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie in den meisten Geschäften so gewesen (in der Assecurazioni Generali, zum Beispiel, war sie zu meiner Zeit wirklich ähnlich, ich erklärte dort dem Direktor, nicht ganz wahrheitsgemäß, aber auch nicht ganz erlogen, meine Kündigung damit, daß ich das Schimpfen, das übrigens mich direkt gar nicht betroffen hatte, nicht ertragen könne; ich war darin zu schmerzhaft empfindlich schon von Hause her), aber die anderen Geschäfte kümmerten mich in der Kinderzeit nicht. Dich aber hörte und sah ich im Geschäft schreien, schimpfen und wüten, wie es meiner damaligen Meinung nach in der ganzen Welt nicht wieder vorkam. Und nicht nur schimpfen, auch sonstige Tyrannei. Wie Du zum Beispiel Waren, die Du mit anderen nicht verwechselt haben wolltest, mit einem Ruck vom Pult hinunterwarfst – nur die Besinnungslosigkeit Deines Zorns entschuldigte Dich ein wenig – und der Kommis sie aufheben mußte. Oder Deine ständige Redensart hinsichtlich eines lungenkranken Kommis: »Er soll krepieren, der kranke Hund.« Du nanntest die Angestellten »bezahlte Feinde«, das waren sie auch, aber noch ehe sie es geworden waren, schienst Du mir ihr »zahlender Feind« zu sein. Dort bekam ich auch die große Lehre, daß Du ungerecht sein könntest; an mir selbst hätte ich es nicht sobald bemerkt, da hatte sich ja zuviel Schuldgefühl angesammelt, das Dir recht gab; aber dort waren nach meiner, später natürlich ein wenig, aber nicht allzusehr korrigierten Kindermeinung fremde Leute, die doch für uns arbeiteten und dafür in fortwährender Angst vor Dir leben mußten. Natürlich übertrieb ich da, und zwar deshalb, weil ich ohneweiters annahm, Du wirktest auf die Leute ebenso schrecklich wie auf mich. Wenn das so gewesen wäre, hätten sie wirklich nicht leben können; da sie aber erwachsene Leute mit meist ausgezeichneten Nerven waren, schüttelten sie das Schimpfen ohne Mühe von sich ab und es schadete Dir schließlich viel mehr als ihnen. Mir aber machte es das Geschäft unleidlich, es erinnerte mich allzusehr an mein Verhältnis zu Dir: Du warst, ganz abgesehen vom Unternehmerinteresse und abgesehen von Deiner Herrschsucht schon als Geschäftsmann allen, die jemals bei Dir gelernt haben, so sehr überlegen, daß Dich keine ihrer Leistungen befriedigen konnte, ähnlich ewig unbefriedigt mußtest Du auch von mir sein. Deshalb gehörte ich notwendig zur Partei des Personals, übrigens auch deshalb, weil ich schon aus Ängstlichkeit nicht begriff, wie man einen Fremden so beschimpfen konnte, und darum aus Ängstlichkeit das meiner Meinung nach fürchterlich aufgebrachte Personal irgendwie mit Dir, mit unserer Familie schon um meiner eigenen Sicherheit willen aussöhnen wollte. Dazu genügte nicht mehr gewöhnliches, anständiges Benehmen gegenüber dem Personal, nicht einmal mehr bescheidenes Benehmen, vielmehr mußte ich demütig sein, nicht nur zuerst grüßen, sondern womöglich auch noch den Gegengruß abwehren. Und hätte ich, die unbedeutende Person, ihnen unten die Füße geleckt, es wäre noch immer kein Ausgleich dafür gewesen, wie Du, der Herr, oben auf sie loshacktest. Dieses Verhältnis, in das ich hier zu Mitmenschen trat, wirkte über das Geschäft hinaus und in die Zukunft weiter (etwas Ähnliches, aber nicht so gefährlich und tiefgreifend wie bei mir, ist zum Beispiel auch Ottlas Vorliebe für den Verkehr mit armen Leuten, das Dich so ärgernde Zusammensitzen mit den Dienstmädchen und dergleichen). Schließlich fürchtete ich mich fast vor dem Geschäft, und jedenfalls war es schon längst nicht mehr meine Sache, ehe ich noch ins Gymnasium kam und dadurch noch weiter davon fortgeführt wurde. Auch schien es mir für meine Fähigkeiten ganz unerschwinglich, da es, wie Du sagtest, selbst die Deinigen verbrauchte. Du suchtest dann (für mich ist das heute rührend und beschämend) aus meiner Dich doch sehr schmerzenden Abneigung gegen das Geschäft, gegen Dein Werk, doch noch ein wenig Süßigkeit für Dich zu ziehen, indem Du behauptetest, mir fehle der Geschäftssinn, ich habe höhere Ideen im Kopf und dergleichen. Die Mutter freute sich natürlich über diese Erklärung, die Du Dir abzwangst, und auch ich in meiner Eitelkeit und Not ließ mich davon beeinflussen. Wären es aber wirklich nur oder hauptsächlich die »höheren Ideen« gewesen, die mich vom Geschäft (das ich jetzt, aber erst jetzt, ehrlich und tatsächlich hasse) abbrachten, sie hätten sich anders äußern müssen, als daß sie mich ruhig und ängstlich durchs Gymnasium und durch das Jusstudium schwimmen ließen, bis ich beim Beamtenschreibtisch endgültig landete.
Wollte ich vor Dir fliehn, mußte ich auch vor der Familie fliehn, selbst vor der Mutter. Man konnte bei ihr zwar immer Schutz finden, doch nur in Beziehung zu Dir. Zu sehr liebte sie Dich und war Dir zu sehr treu ergeben, als daß sie in dem Kampf des Kindes eine selbständige geistige Macht für die Dauer hätte sein können. Ein richtiger Instinkt des Kindes übrigens, denn die Mutter wurde Dir mit den Jahren immer noch enger verbunden; während sie immer, was sie selbst betraf, ihre Selbständigkeit in kleinsten Grenzen schön und zart und ohne Dich jemals wesentlich zu kränken, bewahrte, nahm sie doch mit den Jahren immer vollständiger, mehr im Gefühl als im Verstand, Deine Urteile und Verurteilungen hinsichtlich der Kinder blindlings über, besonders in dem allerdings schweren Fall der Ottla. Freilich muß man immer im Gedächtnis behalten, wie quälend und bis zum letzten aufreibend die Stellung der Mutter in der Familie war. Sie hat sich im Geschäft, im Haushalt geplagt, alle Krankheiten der Familie doppelt mitgelitten, aber die Krönung alles dessen war das, was sie in ihrer Zwischenstellung zwischen uns und Dir gelitten hat. Du bist immer liebend und rücksichtsvoll zu ihr gewesen, aber in dieser Hinsicht hast Du sie ganz genau so wenig geschont, wie wir sie geschont haben. Rücksichtslos haben wir auf sie eingehämmert, Du von Deiner Seite, wir von unserer. Es war eine Ablenkung, man dachte an nichts Böses, man dachte nur an den Kampf, den Du mit uns, den wir mit Dir führten, und auf der Mutter tobten wir uns aus. Es war auch kein guter Beitrag zur Kindererziehung, wie Du sie – ohne jede Schuld Deinerseits natürlich – unseretwegen quältest. Es rechtfertigte sogar scheinbar unser sonst nicht zu rechtfertigendes Benehmen ihr gegenüber. Was hat sie von uns Deinetwegen und von Dir unseretwegen gelitten, ganz ungerechnet jene Fälle, wo Du recht hattest, weil sie uns verzog, wenn auch selbst dieses »Verziehn« manchmal nur eine stille, unbewußte Gegendemonstration gegen Dein System gewesen sein mag. Natürlich hätte die Mutter das alles nicht ertragen können, wenn sie nicht aus der Liebe zu uns allen und aus dem Glück dieser Liebe die Kraft zum Ertragen genommen hätte.
Die Schwestern gingen nur zum Teil mit mir. Am glücklichsten in ihrer Stellung zu Dir war Valli. Am nächsten der Mutter stehend, fügte sie sich Dir auch ähnlich, ohne viel Mühe und Schaden. Du nahmst sie aber auch, eben in Erinnerung an die Mutter, freundlicher hin, trotzdem wenig Kafka’sches Material in ihr war. Aber vielleicht war Dir gerade das recht; wo nichts Kafka’sches war, konntest selbst Du nichts Derartiges verlangen; Du hattest auch nicht, wie bei uns andern, das Gefühl, daß hier etwas verlorenging, das mit Gewalt gerettet werden müßte. Übrigens magst Du das Kafka’sche, soweit es sich in Frauen geäußert hat, niemals besonders geliebt haben. Das Verhältnis Vallis zu Dir wäre sogar vielleicht noch freundlicher geworden, wenn wir anderen es nicht ein wenig gestört hätten.
Die Elli ist das einzige Beispiel für das fast vollständige Gelingen eines Durchbruches aus Deinem Kreis. Von ihr hätte ich es in ihrer Kindheit am wenigsten erwartet. Sie war doch ein so schwerfälliges, müdes, furchtsames, verdrossenes, schuldbewußtes, überdemütiges, boshaftes, faules, genäschiges, geiziges Kind, ich konnte sie kaum ansehn, gar nicht ansprechen, so sehr erinnerte sie mich an mich selbst, so sehr ähnlich stand sie unter dem gleichen Bann der Erziehung. Besonders ihr Geiz war mir abscheulich, da ich ihn womöglich noch stärker hatte. Geiz ist ja eines der verläßlichsten Anzeichen tiefen Unglücklichseins; ich war so unsicher aller Dinge, daß ich tatsächlich nur das besaß, was ich schon in den Händen oder im Mund hielt oder was wenigstens auf dem Wege dorthin war, und gerade das nahm sie, die in ähnlicher Lage war, mir am liebsten fort. Aber das alles änderte sich, als sie in jungen Jahren – das ist das Wichtigste – von zu Hause wegging, heiratete, Kinder bekam, sie wurde fröhlich, unbekümmert, mutig, freigebig, uneigennützig, hoffnungsvoll. Fast unglaublich ist es, wie Du eigentlich diese Veränderung gar nicht bemerkt und jedenfalls nicht nach Verdienst bewertet hast, so geblendet bist Du von dem Groll, den Du gegen Elli seit jeher hattest und im Grunde unverändert hast, nur daß dieser Groll jetzt viel weniger aktuell geworden ist, da Elli nicht mehr bei uns wohnt und außerdem Deine Liebe zu Felix und die Zuneigung zu Karl ihn unwichtiger gemacht haben. Nur Gerti muß ihn manchmal noch entgelten.
Von Ottla wage ich kaum zu schreiben – ich weiß, ich setze damit die ganze erhoffte Wirkung des Briefes aufs Spiel. Unter gewöhnlichen Umständen, also wenn sie nicht etwa in besondere Not oder Gefahr käme, hast Du für sie nur Haß; Du hast mir ja selbst zugestanden, daß sie Deiner Meinung nach mit Absicht Dir immerfort Leid und Ärger macht, und während Du ihretwegen leidest, ist sie befriedigt und freut sich. Also eine Art Teufel. Was für eine ungeheure Entfremdung, noch größer als zwischen Dir und mir, muß zwischen Dir und ihr eingetreten sein, damit eine so ungeheure Verkennung möglich wird. Sie ist so weit von Dir, daß Du sie kaum mehr siehst, sondern ein Gespenst an die Stelle setzt, wo Du sie vermutest. Ich gebe zu, daß Du es mit ihr besonders schwer hattest. Ich durchschaue ja den sehr komplizierten Fall nicht ganz, aber jedenfalls war hier etwas wie eine Art Löwy, ausgestattet mit den besten Kafka’schen Waffen. Zwischen uns war es kein eigentlicher Kampf; ich war bald erledigt; was übrigblieb war Flucht, Verbitterung, Trauer, innerer Kampf. Ihr zwei waret aber immer in Kampfstellung, immer frisch, immer bei Kräften. Ein ebenso großartiger wie trostloser Anblick. Zu allererst seid ihr Euch ja gewiß sehr nahe gewesen, denn noch heute ist von uns vier Ottla vielleicht die reinste Darstellung der Ehe zwischen Dir und der Mutter und der Kräfte, die sich da verbanden. Ich weiß nicht, was Euch um das Glück der Eintracht zwischen Vater und Kind gebracht hat, es liegt mir nur nahe zu glauben, daß die Entwicklung ähnlich war wie bei mir. Auf Deiner Seite die Tyrannei Deines Wesens, auf ihrer Seite Löwyscher Trotz, Empfindlichkeit, Gerechtigkeitsgefühl, Unruhe, und alles das gestützt durch das Bewußtsein Kafka’scher Kraft. Wohl habe auch ich sie beeinflußt, aber kaum aus eigenem Antrieb, sondern durch die bloße Tatsache meines Daseins. Übrigens kam sie doch als letzte in schon fertige Machtverhältnisse hinein und konnte sich aus dem vielen bereitliegenden Material ihr Urteil selbst bilden. Ich kann mir sogar denken, daß sie in ihrem Wesen eine Zeitlang geschwankt hat, ob sie sich Dir an die Brust werfen soll oder den Gegnern, offenbar hast Du damals etwas versäumt und sie zurückgestoßen, Ihr wäret aber, wenn es eben möglich gewesen wäre, ein prachtvolles Paar an Eintracht geworden. Ich hätte dadurch zwar einen Verbündeten verloren, aber der Anblick von Euch beiden hätte mich reich entschädigt, auch wärest ja Du durch das unabsehbare Glück, wenigstens in einem Kind volle Befriedigung zu finden, sehr zu meinen Gunsten verwandelt worden. Das alles ist heute allerdings nur ein Traum. Ottla hat keine Verbindung mit dem Vater, muß ihren Weg allein suchen, wie ich, und um das Mehr an Zuversicht, Selbstvertrauen, Gesundheit, Bedenkenlosigkeit, das sie im Vergleich mit mir hat, ist sie in Deinen Augen böser und verräterischer als ich. Ich verstehe das; von Dir aus gesehen kann sie nicht anders sein. Ja sie selbst ist imstande, mit Deinen Augen sich anzusehen, Dein Leid mitzufühlen und darüber – nicht verzweifelt zu sein, Verzweiflung ist meine Sache – aber sehr traurig zu sein. Du siehst uns zwar, in scheinbarem Widerspruch hiezu, oft beisammen, wir flüstern, lachen, hie und da hörst Du Dich erwähnen. Du hast den Eindruck von frechen Verschwörern. Merkwürdige Verschwörer. Du bist allerdings ein Hauptthema unserer Gespräche wie unseres Denkens seit jeher, aber wahrhaftig nicht, um etwas gegen Dich auszudenken, sitzen wir beisammen, sondern um mit aller Anstrengung, mit Spaß, mit Ernst, mit Liebe, Trotz, Zorn, Widerwille, Ergebung, Schuldbewußtsein, mit allen Kräften des Kopfes und Herzens diesen schrecklichen Prozeß, der zwischen uns und Dir schwebt, in allen Einzelheiten, von allen Seiten, bei allen Anlässen, von fern und nah gemeinsam durchzusprechen, diesen Prozeß, in dem Du immerfort Richter zu sein behauptest, während Du, wenigstens zum größten Teil (hier lasse ich die Tür allen Irrtümern offen, die mir natürlich begegnen können) ebenso schwache und verblendete Partei bist wie wir.
Ein im Zusammenhang des Ganzen lehrreiches Beispiel Deiner erzieherischen Wirkung war Irma. Einerseits war sie doch eine Fremde, kam schon erwachsen in Dein Geschäft, hatte mit Dir hauptsächlich als ihrem Chef zu tun, war also nur zum Teil und in einem schon widerstandsfähigen Alter Deinem Einfluß ausgesetzt; andererseits aber war sie doch auch eine Blutsverwandte, verehrte in Dir den Bruder ihres Vaters, und Du hattest über sie viel mehr als die bloße Macht eines Chefs. Und trotzdem ist sie, die in ihrem schwachen Körper so tüchtig, klug, fleißig, bescheiden, vertrauenswürdig, uneigennützig, treu war, die Dich als Onkel liebte und als Chef bewunderte, die in anderen Posten vorher und nachher sich bewährte, Dir keine sehr gute Beamtin gewesen. Sie war eben, natürlich auch von uns hingedrängt, Dir gegenüber nahe der Kinderstellung, und so groß war noch ihr gegenüber die umbiegende Macht Deines Wesens, daß sich bei ihr (allerdings nur Dir gegenüber und, hoffentlich, ohne das tiefere Leid des Kindes) Vergeßlichkeit, Nachlässigkeit, Galgenhumor, vielleicht sogar ein wenig Trotz, soweit sie dessen überhaupt fähig war, entwickelten, wobei ich gar nicht in Rechnung stelle, daß sie kränklich gewesen ist, auch sonst nicht sehr glücklich war und eine trostlose Häuslichkeit auf ihr lastete. Das für mich Beziehungsreiche Deines Verhältnisses zu ihr hast Du in einem für uns klassisch gewordenen, fast gotteslästerlichen, aber gerade für die Unschuld in Deiner Menschenbehandlung sehr beweisenden Satz zusammengefaßt: »Die Gottselige hat mir viel Schweinerei hinterlassen.«
Ich könnte noch weitere Kreise Deines Einflusses und des Kampfes gegen ihn beschreiben, doch käme ich hier schon ins Unsichere und müßte konstruieren, außerdem wirst Du ja, je weiter Du von Geschäft und Familie Dich entfernst, seit jeher desto freundlicher, nachgiebiger, höflicher, rücksichtsvoller, teilnehmender (ich meine auch äußerlich) ebenso wie ja zum Beispiel auch ein Selbstherrscher, wenn er einmal außerhalb der Grenzen seines Landes ist, keinen Grund hat, noch immer tyrannisch zu sein, und sich gutmütig auch mit den niedrigsten Leuten einlassen kann. Tatsächlich standest Du zum Beispiel auf den Gruppenbildern aus Franzensbad immer so groß und fröhlich zwischen den kleinen mürrischen Leuten, wie ein König auf Reisen. Davon hätten allerdings auch die Kinder ihren Vorteil haben können, nur hätten sie schon, was unmöglich war, in der Kinderzeit fähig sein müssen, das zu erkennen, und ich zum Beispiel hätte nicht immerfort gewissermaßen im innersten, strengsten, zuschnürenden Ring Deines Einflusses wohnen dürfen, wie ich es ja wirklich getan habe.
Ich verlor dadurch nicht nur den Familiensinn, wie Du sagst, im Gegenteil, eher hatte ich noch Sinn für die Familie, allerdings hauptsächlich negativ für die (natürlich nie zu beendigende) innere Ablösung von Dir. Die Beziehungen zu den Menschen außerhalb der Familie litten aber durch Deinen Einfluß womöglich noch mehr. Du bist durchaus im Irrtum, wenn Du glaubst, für die anderen Menschen tue ich aus Liebe und Treue alles, für Dich und die Familie aus Kälte und Verrat nichts. Ich wiederhole zum zehntenmal: ich wäre wahrscheinlich auch sonst ein menschenscheuer, ängstlicher Mensch geworden, aber von da ist noch ein langer, dunkler Weg dorthin, wohin ich wirklich gekommen bin. (Bisher habe ich in diesem Brief verhältnismäßig weniges absichtlich verschwiegen, jetzt und später werde ich aber einiges verschweigen müssen, was – vor Dir und mir – einzugestehen, mir noch zu schwer ist. Ich sage das deshalb, damit Du, wenn das Gesamtbild hie und da etwas undeutlich werden sollte, nicht glaubst, daß Mangel an Beweisen daran schuld ist, es sind vielmehr Beweise da, die das Bild unerträglich kraß machen könnten. Es ist nicht leicht, darin eine Mitte zu finden.) Hier genügt es übrigens, an Früheres zu erinnern: Ich hatte vor Dir das Selbstvertrauen verloren, dafür ein grenzenloses Schuldbewußtsein eingetauscht. (In Erinnerung an diese Grenzenlosigkeit schrieb ich von jemandem einmal richtig: »Er fürchtet, die Scham werde ihn noch überleben.«) Ich konnte mich nicht plötzlich verwandeln, wenn ich mit anderen Menschen zusammenkam, ich kam vielmehr ihnen gegenüber noch in tieferes Schuldbewußtsein, denn ich mußte ja, wie ich schon sagte, das an ihnen gutmachen, was Du unter meiner Mitverantwortung im Geschäft an ihnen verschuldet hattest. Außerdem hattest Du ja gegen jeden, mit dem ich verkehrte, offen oder im Geheimen etwas einzuwenden, auch das mußte ich ihm abbitten. Das Mißtrauen, das Du mir in Geschäft und Familie gegen die meisten Menschen beizubringen suchtest (nenne mir einen in der Kinderzeit irgendwie für mich bedeutenden Menschen, den Du nicht wenigstens einmal bis in den Grund hinunterkritisiert hättest) und das Dich merkwürdigerweise gar nicht besonders beschwerte (Du warst eben stark genug es zu ertragen, außerdem war es in Wirklichkeit vielleicht nur ein Emblem des Herrschers) – dieses Mißtrauen, das sich mir Kleinem für die eigenen Augen nirgends bestätigte, da ich überall nur unerreichbar ausgezeichnete Menschen sah, wurde in mir zu Mißtrauen zu mir selbst und zur fortwährenden Angst vor allem andern. Dort konnte ich mich also im allgemeinen vor Dir gewiß nicht retten. Daß Du Dich darüber täuschtest, lag vielleicht daran, daß Du ja von meinem Menschenverkehr eigentlich gar nichts erfuhrst, und mißtrauisch und eifersüchtig (leugne ich denn, daß Du mich lieb hast?) annahmst, daß ich mich für den Entgang an Familienleben anderswo entschädigen müsse, da es doch unmöglich wäre, daß ich draußen ebenso lebe. Übrigens hatte ich in dieser Hinsicht gerade in meiner Kinderzeit noch einen gewissen Trost eben im Mißtrauen zu meinem Urteil; ich sagte mir: »Du übertreibst doch, fühlst, wie das die Jugend immer tut, Kleinigkeiten zu sehr als große Ausnahmen.« Diesen Trost habe ich aber später bei steigender Weltübersicht fast verloren.
Ebensowenig Rettung vor Dir fand ich im Judentum. Hier wäre ja an sich Rettung denkbar gewesen, aber noch mehr, es wäre denkbar gewesen, daß wir uns beide im Judentum gefunden hätten oder daß wir gar von dort einig ausgegangen wären. Aber was war das für Judentum, das ich von Dir bekam! Ich habe im Laufe der Jahre etwa auf dreierlei Art mich dazu gestellt.
Als Kind machte ich mir, in Übereinstimmung mit Dir, Vorwürfe deshalb, weil ich nicht genügend in den Tempel ging, nicht fastete und so weiter. Ich glaubte nicht mir, sondern Dir ein Unrecht damit zu tun und Schuldbewußtsein, das ja immer bereit war, durchlief mich.
Später, als junger Mensch, verstand ich nicht, wie Du mit dem Nichts von Judentum, über das Du verfügtest, mir Vorwürfe deshalb machen konntest, daß ich (schon aus Pietät, wie Du Dich ausdrücktest) nicht ein ähnliches Nichts auszuführen mich anstrenge. Es war ja wirklich, soweit ich sehen konnte, ein Nichts, ein Spaß, nicht einmal ein Spaß. Du gingst an vier Tagen im Jahr in den Tempel, warst dort den Gleichgültigen zumindest näher als jenen, die es ernst nahmen, erledigtest geduldig die Gebete als Formalität, setztest mich manchmal dadurch in Erstaunen, daß Du mir im Gebetbuch die Stelle zeigen konntest, die gerade rezitiert wurde, im übrigen durfte ich, wenn ich nur (das war die Hauptsache) im Tempel war, mich herumdrücken, wo ich wollte. Ich durchgähnte und durchduselte also dort die vielen Stunden (so gelangweilt habe ich mich später, glaube ich, nur noch in der Tanzstunde) und suchte mich möglichst an den paar kleinen Abwechslungen zu freuen, die es dort gab, etwa wenn die Bundeslade aufgemacht wurde, was mich immer an die Schießbuden erinnerte, wo auch, wenn man in ein Schwarzes traf, eine Kastentür sich aufmachte, nur daß dort aber immer etwas Interessantes herauskam und hier nur immer wieder die alten Puppen ohne Köpfe. Übrigens habe ich dort auch viel Furcht gehabt, nicht nur, wie selbstverständlich, vor den vielen Leuten, mit denen man in nähere Berührung kam, sondern auch deshalb, weil Du einmal nebenbei erwähntest, daß auch ich zur Thora aufgerufen werden könne. Davor zitterte ich jahrelang. Sonst aber wurde ich in meiner Langweile nicht wesentlich gestört, höchstens durch die Barmizwe, die aber nur lächerliches Auswendiglernen verlangte, also nur zu einer lächerlichen Prüfungsleistung führte, und dann, was Dich betrifft, durch kleine, wenig bedeutende Vorfälle, etwa wenn Du zur Thora gerufen wurdest und dieses für mein Gefühl ausschließlich gesellschaftliche Ereignis gut überstandest oder wenn Du bei der Seelengedächtnisfeier im Tempel bliebst und ich weggeschickt wurde, was mir durch lange Zeit, offenbar wegen des Weggeschicktwerdens und mangels jeder tieferen Teilnahme, das kaum bewußt werdende Gefühl hervorrief, daß es sich hier um etwas Unanständiges handle. – So war es im Tempel, zu Hause war es womöglich noch ärmlicher und beschränkte sich auf den ersten Sederabend, der immer mehr zu einer Komödie mit Lachkrämpfen wurde, allerdings unter dem Einfluß der größer werdenden Kinder. (Warum mußtest Du Dich diesem Einfluß fügen? Weil Du ihn hervorgerufen hast.) Das war also das Glaubensmaterial, das mir überliefert wurde, dazu kam höchstens noch die ausgestreckte Hand, die auf »die Söhne des Millionärs Fuchs« hinwies, die an hohen Feiertagen mit ihrem Vater im Tempel waren. Wie man mit diesem Material etwas Besseres tun könnte, als es möglichst schnell loszuwerden, verstand ich nicht; gerade dieses Loswerden schien mir die pietätvollste Handlung zu sein.
Noch später sah ich es aber doch wieder anders an und begriff, warum Du glauben durftest, daß ich Dich auch in dieser Hinsicht böswillig verrate. Du hattest aus der kleinen ghettoartigen Dorfgemeinde wirklich noch etwas Judentum mitgebracht, es war nicht viel und verlor sich noch ein wenig in der Stadt und beim Militär, immerhin reichten noch die Eindrücke und Erinnerungen der Jugend knapp zu einer Art jüdischen Lebens aus, besonders da Du ja nicht viel derartige Hilfe brauchtest, sondern von einem sehr kräftigen Stamm warst und für Deine Person von religiösen Bedenken, wenn sie nicht mit gesellschaftlichen Bedenken sich sehr mischten, kaum erschüttert werden konntest. Im Grund bestand der Dein Leben führende Glaube darin, daß Du an die unbedingte Richtigkeit der Meinungen einer bestimmten jüdischen Gesellschaftsklasse glaubtest und eigentlich also, da diese Meinungen zu Deinem Wesen gehörten, Dir selbst glaubtest. Auch darin lag noch genug Judentum, aber zum Weiter-überliefert-werden war es gegenüber dem Kind zu wenig, es vertropfte zur Gänze, während Du es weitergabst. Zum Teil waren es unüberlieferbare Jugendeindrücke, zum Teil Dein gefürchtetes Wesen. Es war auch unmöglich, einem vor lauter Ängstlichkeit überscharf beobachtenden Kind begreiflich zu machen, daß die paar Nichtigkeiten, die Du im Namen des Judentums mit einer ihrer Nichtigkeit entsprechenden Gleichgültigkeit ausführtest, einen höheren Sinn haben konnten. Für Dich hatten sie Sinn als kleine Andenken aus früheren Zeiten, und deshalb wolltest Du sie mir vermitteln, konntest dies aber, da sie ja auch für Dich keinen Selbstwert mehr hatten, nur durch Überredung oder Drohung tun; das konnte einerseits nicht gelingen und mußte andererseits Dich, da Du Deine schwache Position hier gar nicht erkanntest, sehr zornig gegen mich wegen meiner scheinbaren Verstocktheit machen.
Das Ganze ist ja keine vereinzelte Erscheinung, ähnlich verhielt es sich bei einem großen Teil dieser jüdischen Übergangsgeneration, welche vom verhältnismäßig noch frommen Land in die Städte auswanderte; das ergab sich von selbst, nur fügte es eben unserem Verhältnis, das ja an Schärfen keinen Mangel hatte, noch eine genug schmerzliche hinzu. Dagegen sollst Du zwar auch in diesem Punkt, ebenso wie ich, an Deine Schuldlosigkeit glauben, diese Schuldlosigkeit aber durch Dein Wesen und durch die Zeitverhältnisse erklären, nicht aber bloß durch die äußeren Umstände, also nicht etwa sagen, Du hättest zu viel andere Arbeit und Sorgen gehabt, als daß Du Dich auch noch mit solchen Dingen hättest abgeben können. Auf diese Weise pflegst Du aus Deiner zweifellosen Schuldlosigkeit einen ungerechten Vorwurf gegen andere zu drehen. Das ist dann überall und auch hier sehr leicht zu widerlegen. Es hätte sich doch nicht etwa um irgendeinen Unterricht gehandelt, den Du Deinen Kindern hättest geben sollen, sondern um ein beispielhaftes Leben; wäre Dein Judentum stärker gewesen, wäre auch Dein Beispiel zwingender gewesen, das ist ja selbstverständlich und wieder gar kein Vorwurf, sondern nur eine Abwehr Deiner Vorwürfe. Du hast letzthin Franklins Jugenderinnerungen gelesen. Ich habe sie Dir wirklich absichtlich zum Lesen gegeben, aber nicht, wie Du ironisch bemerktest, wegen einer kleinen Stelle über Vegetarianismus, sondern wegen des Verhältnisses zwischen dem Verfasser und seinem Vater, wie es dort beschrieben ist, und des Verhältnisses zwischen dem Verfasser und seinem Sohn, wie es sich von selbst in diesen für den Sohn geschriebenen Erinnerungen ausdrückt. Ich will hier nicht Einzelheiten hervorheben.
Eine gewisse nachträgliche Bestätigung dieser Auffassung von Deinem Judentum bekam ich auch durch Dein Verhalten in den letzten Jahren, als es Dir schien, daß ich mich mit jüdischen Dingen mehr beschäftige. Da Du von vornherein gegen jede meiner Beschäftigungen und besonders gegen die Art meiner Interessennahme eine Abneigung hast, so hattest Du sie auch hier. Aber darüber hinaus hätte man doch erwarten können, daß Du hier eine kleine Ausnahme machst. Es war doch Judentum von Deinem Judentum, das sich hier regte, und damit also auch die Möglichkeit der Anknüpfung neuer Beziehungen zwischen uns. Ich leugne nicht, daß mir diese Dinge, wenn Du für sie Interesse gezeigt hättest, gerade dadurch hätten verdächtig werden können. Es fällt mir ja nicht ein, behaupten zu wollen, daß ich in dieser Hinsicht irgendwie besser bin als Du. Aber zu der Probe darauf kam es gar nicht. Durch meine Vermittlung wurde Dir das Judentum abscheulich, jüdische Schriften unlesbar, sie »ekelten Dich an«. Das konnte bedeuten, daß Du darauf bestandest, nur gerade das Judentum, wie Du es mir in meiner Kinderzeit gezeigt hattest, sei das einzig Richtige, darüber hinaus gebe es nichts. Aber daß Du darauf bestehen solltest, war doch kaum denkbar. Dann aber konnte der »Ekel« (abgesehen davon, daß er sich zunächst nicht gegen das Judentum, sondern gegen meine Person richtete) nur bedeuten, daß Du unbewußt die Schwäche Deines Judentums und meiner jüdischen Erziehung anerkanntest, auf keine Weise daran erinnert werden wolltest und auf alle Erinnerungen mit offenem Hasse antwortetest. Übrigens war Deine negative Hochschätzung meines neuen Judentums sehr übertrieben; erstens trug es ja Deinen Fluch in sich und zweitens war für seine Entwicklung das grundsätzliche Verhältnis zu den Mitmenschen entscheidend, in meinem Fall also tödlich.
Richtiger trafst Du mit Deiner Abneigung mein Schreiben und was, Dir unbekannt, damit zusammenhing. Hier war ich tatsächlich ein Stück selbständig von Dir weggekommen, wenn es auch ein wenig an den Wurm erinnerte, der, hinten von einem Fuß niedergetreten, sich mit dem Vorderteil losreißt und zur Seite schleppt. Einigermaßen in Sicherheit war ich, es gab ein Aufatmen; die Abneigung, die Du natürlich auch gleich gegen mein Schreiben hattest, war mir hier ausnahmsweise willkommen. Meine Eitelkeit, mein Ehrgeiz litten zwar unter Deiner für uns berühmt gewordenen Begrüßung meiner Bücher: »Legs auf den Nachttisch!« (meistens spieltest Du ja Karten, wenn ein Buch kam), aber im Grunde war mir dabei doch wohl, nicht nur aus aufbegehrender Bosheit, nicht nur aus Freude über eine neue Bestätigung meiner Auffassung unseres Verhältnisses, sondern ganz ursprünglich, weil jene Formel mir klang wie etwa: »Jetzt bist Du frei!« Natürlich war es eine Täuschung, ich war nicht oder allergünstigsten Falles noch nicht frei. Mein Schreiben handelte von Dir, ich klagte dort ja nur, was ich an Deiner Brust nicht klagen konnte. Es war ein absichtlich in die Länge gezogener Abschied von Dir, nur daß er zwar von Dir erzwungen war, aber in der von mir bestimmten Richtung verlief. Aber wie wenig war das alles! Es ist ja überhaupt nur deshalb der Rede wert, weil es sich in meinem Leben ereignet hat, anderswo wäre es gar nicht zu merken, und dann noch deshalb, weil es mir in der Kindheit als Ahnung, später als Hoffnung, noch später oft als Verzweiflung mein Leben beherrschte und mir – wenn man will, doch wieder in Deiner Gestalt – meine paar kleinen Entscheidungen diktierte.
Zum Beispiel die Berufswahl. Gewiß, Du gabst mir hier völlige Freiheit in Deiner großzügigen und in diesem Sinn sogar geduldigen Art. Allerdings folgtest Du hiebei auch der für Dich maßgebenden allgemeinen Söhnebehandlung des jüdischen Mittelstandes oder zumindest den Werturteilen dieses Standes. Schließlich wirkte hiebei auch eines Deiner Mißverständnisse hinsichtlich meiner Person mit. Du hältst mich nämlich seit jeher aus Vaterstolz, aus Unkenntnis meines eigentlichen Daseins, aus Rückschlüssen aus meiner Schwächlichkeit für besonders fleißig. Als Kind habe ich Deiner Meinung nach immerfort gelernt und später immerfort geschrieben. Das stimmt nun nicht im entferntesten. Eher kann man mit viel weniger Übertreibung sagen, daß ich wenig gelernt und nichts erlernt habe; daß etwas in den vielen Jahren bei einem mittleren Gedächtnis, bei nicht allerschlechtester Auffassungskraft hängengeblieben ist, ist ja nicht sehr merkwürdig, aber jedenfalls ist das Gesamtergebnis an Wissen, und besonders an Fundierung des Wissens, äußerst kläglich im Vergleich zu dem Aufwand an Zeit und Geld inmitten eines äußerlich sorglosen, ruhigen Lebens, besonders auch im Vergleich zu fast allen Leuten, die ich kenne. Es ist kläglich, aber für mich verständlich. Ich hatte, seitdem ich denken kann, solche tiefste Sorgen der geistigen Existenzbehauptung, daß mir alles andere gleichgültig war. Jüdische Gymnasiasten bei uns sind leicht merkwürdig, man findet da das Unwahrscheinlichste, aber meine kalte, kaum verhüllte, unzerstörbare, kindlich hilflose, bis ins Lächerliche gehende, tierisch selbstzufriedene Gleichgültigkeit eines für sich genug, aber kalt phantastischen Kindes habe ich sonst nirgends wieder gefunden, allerdings war sie hier auch der einzige Schutz gegen die Nervenzerstörung durch Angst und Schuldbewußtsein. Mich beschäftigte nur die Sorge um mich, diese aber in verschiedenster Weise. Etwa als Sorge um meine Gesundheit; es fing leicht an, hier und dort ergab sich eine kleine Befürchtung wegen der Verdauung, des Haarausfalls, einer Rückgratsverkrümmung und so weiter, das steigerte sich in unzählbaren Abstufungen, schließlich endete es mit einer wirklichen Krankheit. Aber da ich keines Dinges sicher war, von jedem Augenblick eine neue Bestätigung meines Daseins brauchte, nichts in meinem eigentlichen, unzweifelhaften, alleinigen, nur durch mich eindeutig bestimmten Besitz war, in Wahrheit ein enterbter Sohn, wurde mir natürlich auch das Nächste, der eigene Körper unsicher; ich wuchs lang in die Höhe, wußte damit aber nichts anzufangen, die Last war zu schwer, der Rücken wurde krumm; ich wagte mich kaum zu bewegen oder gar zu turnen, ich blieb schwach; staunte alles, worüber ich noch verfügte, als Wunder an, etwa meine gute Verdauung; das genügte, um sie zu verlieren, und damit war der Weg zu aller Hypochondrie frei, bis dann unter der übermenschlichen Anstrengung des Heiraten-Wollens (darüber spreche ich noch) das Blut aus der Lunge kam, woran ja die Wohnung im Schönbornpalais – die ich aber nur deshalb brauchte, weil ich sie für mein Schreiben zu brauchen glaubte, so daß auch das auf dieses Blatt gehört – genug Anteil haben kann. Also das alles stammte nicht von übergroßer Arbeit, wie Du Dir es immer vorstellst. Es gab Jahre, in denen ich bei voller Gesundheit mehr Zeit auf dem Kanapee verfaulenzt habe, als Du in Deinem ganzen Leben, alle Krankheiten eingerechnet. Wenn ich höchstbeschäftigt von Dir fortlief, war es meist, um mich in meinem Zimmer hinzulegen. Meine Gesamtarbeitsleistung sowohl im Büro (wo allerdings Faulheit nicht sehr auffällt und überdies durch meine Ängstlichkeit in Grenzen gehalten war) als auch zu Hause ist winzig; hättest Du darüber einen Überblick, würde es Dich entsetzen. Wahrscheinlich bin ich in meiner Anlage gar nicht faul, aber es gab für mich nichts zu tun. Dort, wo ich lebte, war ich verworfen, abgeurteilt, niedergekämpft, und anderswohin mich zu flüchten strengte mich zwar äußerst an, aber das war keine Arbeit, denn es handelte sich um Unmögliches, das für meine Kräfte bis auf kleine Ausnahmen unerreichbar war.
In diesem Zustand bekam ich also die Freiheit der Berufswahl. War ich aber überhaupt noch fähig, eine solche Freiheit eigentlich zu gebrauchen? Traute ich mir es denn noch zu, einen wirklichen Beruf erreichen zu können? Meine Selbstbewertung war von Dir viel abhängiger als von irgend etwas sonst, etwa von einem äußeren Erfolg. Der war die Stärkung eines Augenblicks, sonst nichts, aber auf der anderen Seite zog Dein Gewicht immer viel stärker hinunter. Niemals würde ich durch die erste Volksschulklasse kommen, dachte ich, aber es gelang, ich bekam sogar eine Prämie; aber die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium würde ich gewiß nicht bestehn, aber es gelang; aber nun falle ich in der ersten Gymnasialklasse bestimmt durch, nein, ich fiel nicht durch und es gelang immer weiter und weiter. Daraus ergab sich aber keine Zuversicht, im Gegenteil, immer war ich überzeugt – und in Deiner abweisenden Miene halte ich förmlich den Beweis dafür – daß, je mehr mir gelingt, desto schlimmer es schließlich wird ausgehn müssen. Oft sah ich im Geist die schreckliche Versammlung der Professoren (das Gymnasium ist nur das einheitlichste Beispiel, überall um mich war es aber ähnlich), wie sie, wenn ich die Prima überstanden hatte, also in der Sekunda, wenn ich diese überstanden hatte, also in der Tertia und so weiter zusammenkommen würden, um diesen einzigartigen, himmelschreienden Fall zu untersuchen, wie es mir, dem Unfähigsten und jedenfalls Unwissendsten gelungen war, mich bis hinauf in diese Klasse zu schleichen, die mich, da nun die allgemeine Aufmerksamkeit auf mich gelenkt war, natürlich sofort ausspeien würde, zum Jubel aller von diesem Albdruck befreiten Gerechten. – Mit solchen Vorstellungen zu leben ist für ein Kind nicht leicht. Was kümmerte mich unter diesen Umständen der Unterricht. Wer war imstande, aus mir einen Funken von Anteilnahme herauszuschlagen? Mich interessierte der Unterricht – und nicht nur der Unterricht, sondern alles ringsherum in diesem entscheidenden Alter – etwa so wie einen Bankdefraudanten, der noch in Stellung ist und vor der Entdeckung zittert, das kleine laufende Bankgeschäft interessiert, das er noch immer als Beamter zu erledigen hat. So klein, so fern war alles neben der Hauptsache. Es ging dann weiter bis zur Matura, durch die ich wirklich schon zum Teil nur durch Schwindel kam, und dann stockte es, jetzt war ich frei. Hatte ich schon trotz dem Zwang des Gymnasiums mich nur um mich gekümmert, wie erst jetzt, da ich frei war. Also eigentliche Freiheit der Berufswahl gab es für mich nicht, ich wußte: alles wird mir gegenüber der Hauptsache genau so gleichgültig sein, wie alle Lehrgegenstände im Gymnasium, es handelt sich also darum, einen Beruf zu finden, der mir, ohne meine Eitelkeit allzusehr zu verletzen, diese Gleichgültigkeit am ehesten erlaubt. Also war Jus das Selbstverständliche. Kleine gegenteilige Versuche der Eitelkeit, der unsinnigen Hoffnung, wie vierzehntägiges Chemiestudium, halbjähriges Deutschstudium, verstärkten nur jene Grundüberzeugung. Ich studierte also Jus. Das bedeutete, daß ich mich in den paar Monaten vor den Prüfungen unter reichlicher Mitnahme der Nerven geistig förmlich von Holzmehl nährte, das mir überdies schon von tausenden Mäulern vorgekaut war. Aber in gewissem Sinn schmeckte mir das gerade, wie in gewissem Sinn früher auch das Gymnasium und später der Beamtenberuf, denn das alles entsprach vollkommen meiner Lage. Jedenfalls zeigte ich hier erstaunliche Voraussicht, schon als kleines Kind hatte ich hinsichtlich der Studien und des Berufes genug klare Vorahnungen. Von hier aus erwartete ich keine Rettung, hier hatte ich schon längst verzichtet.
Gar keine Voraussicht zeigte ich aber hinsichtlich der Bedeutung und Möglichkeit einer Ehe für mich; dieser bisher größte Schrecken meines Lebens ist fast vollständig unerwartet über mich gekommen. Das Kind hatte sich so langsam entwickelt, diese Dinge lagen ihm äußerlich gar zu abseits; hie und da ergab sich die Notwendigkeit, daran zu denken; daß sich hier aber eine dauernde, entscheidende und sogar die erbitterteste Prüfung vorbereite, war nicht zu erkennen. In Wirklichkeit aber wurden die Heiratsversuche der großartigste und hoffnungsreichste Rettungsversuch, entsprechend großartig war dann allerdings auch das Mißlingen.
Ich fürchte, weil mir in dieser Gegend alles mißlingt, daß es mir auch nicht gelingen wird, Dir diese Heiratsversuche verständlich zu machen. Und doch hängt das Gelingen des ganzen Briefes davon ab, denn in diesen Versuchen war einerseits alles versammelt, was ich an positiven Kräften zur Verfügung hatte, andererseits sammelten sich hier auch geradezu mit Wut alle negativen Kräfte, die ich als Mitergebnis Deiner Erziehung beschrieben habe, also die Schwäche, der Mangel an Selbstvertrauen, das Schuldbewußtsein, und zogen förmlich einen Kordon zwischen mir und der Heirat. Die Erklärung wird mir auch deshalb schwer werden, weil ich hier alles in so vielen Tagen und Nächten immer wieder durchdacht und durchgraben habe, daß selbst mich jetzt der Anblick schon verwirrt. Erleichtert wird mir die Erklärung nur durch Dein meiner Meinung nach vollständiges Mißverstehn der Sache; ein so vollständiges Mißverstehn ein wenig zu verbessern, scheint nicht übermäßig schwer.
Zunächst stellst du das Mißlingen der Heiraten in die Reihe meiner sonstigen Mißerfolge; dagegen hätte ich an sich nichts, vorausgesetzt, daß Du meine bisherige Erklärung des Mißerfolgs annimmst. Es steht tatsächlich in dieser Reihe, nur die Bedeutung der Sache unterschätzst Du und unterschätzst sie derartig, daß wir, wenn wir miteinander davon reden, eigentlich von ganz Verschiedenem sprechen. Ich wage zu sagen, daß Dir in Deinem ganzen Leben nichts geschehen ist, was für Dich eine solche Bedeutung gehabt hätte, wie für mich die Heiratsversuche. Damit meine ich nicht, daß Du an sich nichts so Bedeutendes erlebt hättest, im Gegenteil, Dein Leben war viel reicher und sorgenvoller und gedrängter als meines, aber eben deshalb ist Dir nichts Derartiges geschehen. Es ist so, wie wenn einer fünf niedrige Treppenstufen hinaufzusteigen hat und ein zweiter nur eine Treppenstufe, die aber, wenigstens für ihn, so hoch ist, wie jene fünf zusammen; der erste wird nicht nur die fünf bewältigen, sondern noch hunderte und tausende weitere, er wird ein großes und sehr anstrengendes Leben geführt haben, aber keine der Stufen, die er erstiegen hat, wird für ihn eine solche Bedeutung gehabt haben, wie für den zweiten jene eine, erste, hohe, für alle seine Kräfte unmöglich zu ersteigende Stufe, zu der er nicht hinauf- und über die er natürlich auch nicht hinauskommt.
Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen, hinnehmen, in dieser unsicheren Welt erhalten und gar noch ein wenig führen, ist meiner Überzeugung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann. Daß es scheinbar so vielen leicht gelingt, ist kein Gegenbeweis, denn erstens gelingt es tatsächlich nicht vielen, und zweitens ›tun‹ es diese Nichtvielen meistens nicht, sondern es ›geschieht‹ bloß mit ihnen; das ist zwar nicht jenes Äußerste, aber doch noch sehr groß und sehr ehrenvoll (besonders da sich ›tun‹ und ›geschehn‹ nicht rein voneinander scheiden lassen). Und schließlich handelt es sich auch gar nicht um dieses Äußerste, sondern nur um irgendeine ferne, aber anständige Annäherung; es ist doch nicht notwendig, mitten in die Sonne hineinzufliegen, aber doch bis zu einem reinen Plätzchen auf der Erde hinzukriechen, wo manchmal die Sonne hinscheint und man sich ein wenig wärmen kann.
Wie war ich nun auf dieses vorbereitet? Möglichst schlecht. Das geht schon aus dem Bisherigen hervor. Soweit es aber dafür eine direkte Vorbereitung des Einzelnen und eine direkte Schaffung der allgemeinen Grundbedingungen gibt, hast Du äußerlich nicht viel eingegriffen. Es ist auch nicht anders möglich, hier entscheiden die allgemeinen geschlechtlichen Standes-, Volks- und Zeitsitten. Immerhin hast Du auch da eingegriffen, nicht viel, denn die Voraussetzung solchen Eingreifens kann nur starkes gegenseitiges Vertrauen sein, und daran fehlte es uns beiden schon längst zur entscheidenden Zeit, und nicht sehr glücklich, weil ja unsere Bedürfnisse ganz verschieden waren; was mich packt, muß Dich noch kaum berühren und umgekehrt, was bei Dir Unschuld ist, kann bei mir Schuld sein und umgekehrt, was bei Dir folgenlos bleibt, kann mein Sargdeckel sein.
Ich erinnere mich, ich ging einmal abends mit Dir und der Mutter spazieren, es war auf dem Josephsplatz in der Nähe der heutigen Länderbank, und fing dumm großtuerisch, überlegen, stolz, kühl (das war unwahr), kalt (das war echt) und stotternd, wie ich eben meistens mit Dir sprach, von den interessanten Sachen zu reden an, machte Euch Vorwürfe, daß ich unbelehrt gelassen worden bin, daß sich erst die Mitschüler meiner hatten annehmen müssen, daß ich in der Nähe großer Gefahren gewesen bin (hier log ich meiner Art nach unverschämt, um mich mutig zu zeigen, denn infolge meiner Ängstlichkeit hatte ich keine genauere Vorstellung von den ›großen Gefahren‹), deutete aber zum Schluß an, daß ich jetzt schon glücklicherweise alles wisse, keinen Rat mehr brauche und alles in Ordnung sei. Hauptsächlich hatte ich davon jedenfalls zu reden angefangen, weil es mir Lust machte, davon wenigstens zu reden, dann auch aus Neugierde und schließlich auch, um mich irgendwie für irgend etwas an Euch zu rächen. Du nahmst es entsprechend Deinem Wesen sehr einfach, Du sagtest nur etwa, Du könntest mir einen Rat geben, wie ich ohne Gefahr diese Dinge werde betreiben können. Vielleicht hatte ich gerade eine solche Antwort hervorlocken wollen, die entsprach ja der Lüsternheit des mit Fleisch und allen guten Dingen überfütterten, körperlich untätigen, mit sich ewig beschäftigten Kindes, aber doch war meine äußerliche Scham dadurch so verletzt oder ich glaubte, sie müsse so verletzt sein, daß ich gegen meinen Willen nicht mehr mit Dir darüber sprechen konnte und hochmütig frech das Gespräch abbrach.
Es ist nicht leicht, Deine damalige Antwort zu beurteilen. einerseits hat sie doch etwas niederwerfend Offenes, gewissermaßen Urzeitliches, andererseits ist sie allerdings, was die Lehre selbst betrifft, sehr neuzeitlich bedenkenlos. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, viel älter als sechzehn Jahre gewiß nicht. Für einen solchen Jungen war es aber doch eine sehr merkwürdige Antwort, und der Abstand zwischen uns beiden zeigt sich auch darin, daß das eigentlich die erste direkte, lebenumfassende Lehre war, die ich von Dir bekam. Ihr eigentlicher Sinn aber, der sich schon damals in mich einsenkte, mir aber erst viel später halb zu Bewußtsein kam, war folgender: Das, wozu Du mir rietest, war doch das Deiner Meinung nach und gar erst meiner damaligen Meinung nach Schmutzigste, was es gab. Daß Du dafür sorgen wolltest, daß ich körperlich von dem Schmutz nichts nach Hause bringe, war nebensächlich, dadurch schütztest Du ja nur Dich, Dein Haus. Die Hauptsache war vielmehr, daß Du außerhalb Deines Rates bliebst, ein Ehemann, ein reiner Mann, erhaben über diese Dinge; das verschärfte sich damals für mich wahrscheinlich noch dadurch, daß mir auch die Ehe schamlos vorkam und es mir daher unmöglich war, das, was ich Allgemeines über die Ehe gehört hatte, auf meine Eltern anzuwenden. Dadurch wurdest Du noch reiner, kamst noch höher. Der Gedanke, daß Du etwa vor der Ehe auch Dir einen ähnlichen Rat hättest geben können, war mir völlig undenkbar. So war also fast kein Restchen irdischen Schmutzes an Dir. Und eben Du stießest mich, so als wäre ich dazu bestimmt, mit ein paar offenen Worten in diesen Schmutz hinunter. Bestand die Welt also nur aus mir und Dir, eine Vorstellung, die mir sehr nahelag, dann endete also mit Dir diese Reinheit der Welt, und mit mir begann kraft Deines Rates der Schmutz. An sich war es ja unverständlich, daß Du mich so verurteiltest, nur alte Schuld und tiefste Verachtung Deinerseits konnten mir das erklären. Und damit war ich also wieder in meinem innersten Wesen angefaßt, und zwar sehr hart.
Hier wird vielleicht auch unser beider Schuldlosigkeit am deutlichsten. A gibt dem B einen offenen, seiner Lebensauffassung entsprechenden, nicht sehr schönen, aber doch auch heute in der Stadt durchaus üblichen, Gesundheitsschädigungen vielleicht verhindernden Rat. Dieser Rat ist für B moralisch nicht sehr stärkend, aber warum sollte er sich aus dem Schaden nicht im Laufe der Jahre herausarbeiten können, übrigens muß er ja dem Rat gar nicht folgen, und jedenfalls liegt in dem Rat allein kein Anlaß dafür, daß über B etwa seine ganze Zukunftswelt zusammenbricht. Und doch geschieht etwas in dieser Art, aber eben nur deshalb, weil A Du bist und B ich bin.
Diese beiderseitige Schuldlosigkeit kann ich auch deshalb besonders gut überblicken, weil sich ein ähnlicher Zusammenstoß zwischen uns unter ganz anderen Verhältnissen etwa zwanzig Jahre später wieder ereignet hat, als Tatsache grauenhaft, an und für sich allerdings viel unschädlicher, denn wo war da etwas an mir Sechsunddreißigjährigem, dem noch geschadet werden konnte. Ich meine damit eine kleine Aussprache an einem der paar aufgeregten Tage nach Mitteilung meiner letzten Heiratsabsicht. Du sagtest zu mir etwa: »Sie hat wahrscheinlich irgendeine ausgesuchte Bluse angezogen, wie das die Prager Jüdinnen verstehn, und daraufhin hast Du Dich natürlich entschlossen, sie zu heiraten. Und zwar möglichst rasch, in einer Woche, morgen, heute. Ich begreife Dich nicht, Du bist doch ein erwachsener Mensch, bist in der Stadt, und weißt Dir keinen andern Rat als gleich eine Beliebige zu heiraten. Gibt es da keine anderen Möglichkeiten? Wenn Du Dich davor fürchtest, werde ich selbst mit Dir hingehn.« Du sprachst ausführlicher und deutlicher, aber ich kann mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern, vielleicht wurde mir auch ein wenig nebelhaft vor den Augen, fast interessierte mich mehr die Mutter, wie sie, zwar vollständig mit Dir einverstanden, immerhin etwas vom Tisch nahm und damit aus dem Zimmer ging.
Tiefer gedemütigt hast Du mich mit Worten wohl kaum und deutlicher mir Deine Verachtung nie gezeigt. Als Du vor zwanzig Jahren ähnlich zu mir gesprochen hattest, hätte man darin mit Deinen Augen sogar etwas Respekt für den frühreifen Stadtjungen sehen können, der Deiner Meinung nach schon so ohne Umwege ins Leben eingeführt werden konnte. Heute könnte diese Rücksicht die Verachtung nur noch steigern, denn der Junge, der damals einen Anlauf nahm, ist in ihm steckengeblieben und scheint Dir heute um keine Erfahrung reicher, sondern nur um zwanzig Jahre jämmerlicher. Meine Entscheidung für ein Mädchen bedeutete Dir gar nichts. Du hattest meine Entscheidungskraft (unbewußt) immer niedergehalten und glaubtest jetzt (unbewußt) zu wissen, was sie wert war. Von meinen Rettungsversuchen in anderen Richtungen wußtest Du nichts, daher konntest Du auch von den Gedankengängen, die mich zu diesem Heiratsversuch geführt hatten, nichts wissen, mußtest sie zu erraten suchen und rietst entsprechend dem Gesamturteil, das Du über mich hattest, auf das Abscheulichste, Plumpste, Lächerlichste. Und zögertest keinen Augenblick, mir das auf ebensolche Weise zu sagen. Die Schande, die Du damit mir antatest, war Dir nichts im Vergleich zu der Schande, die ich Deiner Meinung nach Deinem Namen durch die Heirat machen würde.
Nun kannst Du ja hinsichtlich meiner Heiratsversuche manches mir antworten und hast es auch getan: Du könntest nicht viel Respekt vor meiner Entscheidung haben, wenn ich die Verlobung mit F. zweimal aufgelöst und zweimal wieder auf genommen habe, wenn ich dich und die Mutter nutzlos zu der Verlobung nach Berlin geschleppt habe und dergleichen. Das alles ist wahr, aber wie kam es dazu?
Der Grundgedanke beider Heiratsversuche war ganz korrekt: einen Hausstand gründen, selbständig werden. Ein Gedanke, der Dir ja sympathisch ist, nur daß es dann in Wirklichkeit so ausfällt wie das Kinderspiel, wo einer die Hand des anderen hält und sogar preßt und dabei ruft: »Ach geh doch, geh doch, warum gehst Du nicht?« Was sich allerdings in unserem Fall dadurch kompliziert hat, daß Du das »geh doch!« seit jeher ehrlich gemeint hast, da Du ebenso seit jeher, ohne es zu wissen, nur kraft Deines Wesens mich gehalten oder richtiger niedergehalten hast.
Beide Mädchen waren zwar durch den Zufall, aber außerordentlich gut gewählt. Wieder ein Zeichen Deines vollständigen Mißverstehns, daß Du glauben kannst, ich, der Ängstliche, Zögernde, Verdächtigende entschließe mich mit einem Ruck für eine Heirat, etwa aus Entzücken über eine Bluse. Beide Ehen wären vielmehr Vernunftehen geworden, soweit damit gesagt ist, daß Tag und Nacht, das erste Mal Jahre, das zweite Mal Monate, alle meine Denkkraft an den Plan gewendet worden ist.
Keines der Mädchen hat mich enttäuscht, nur ich sie beide. Mein Urteil über sie ist heute genau das gleiche wie damals, als ich sie heiraten wollte.
Es ist auch nicht so, daß ich beim zweiten Heiratsversuch die Erfahrungen des ersten Versuches mißachtet hätte, also leichtsinnig gewesen wäre. Die Fälle waren eben ganz verschieden, gerade die früheren Erfahrungen konnten mir im zweiten Fall, der überhaupt viel aussichtsreicher war, Hoffnung geben. Von Einzelheiten will ich hier nicht reden.
Warum also habe ich nicht geheiratet? Es gab einzelne Hindernisse wie überall, aber im Nehmen solcher Hindernisse besteht ja das Leben. Das wesentliche, vom einzelnen Fall leider unabhängige Hindernis war aber, daß ich offenbar geistig unfähig bin zu heiraten. Das äußert sich darin, daß ich von dem Augenblick an, in dem ich mich entschließe zu heiraten, nicht mehr schlafen kann, der Kopf glüht bei Tag und Nacht, es ist kein Leben mehr, ich schwanke verzweifelt herum. Es sind das nicht eigentlich Sorgen, die das verursachen, zwar laufen auch entsprechend meiner Schwerblütigkeit und Pedanterie unzählige Sorgen mit, aber sie sind nicht das Entscheidende, sie vollenden zwar wie Würmer die Arbeit am Leichnam, aber entscheidend getroffen bin ich von anderem. Es ist der allgemeine Druck der Angst, der Schwäche, der Selbstmißachtung.
Ich will es näher zu erklären versuchen: Hier beim Heiratsversuch trifft in meinen Beziehungen zu Dir zweierlei scheinbar Entgegengesetztes so stark wie nirgends sonst zusammen. Die Heirat ist gewiß die Bürgschaft für die schärfste Selbstbefreiung und Unabhängigkeit. Ich hätte eine Familie, das Höchste, was man meiner Meinung nach erreichen kann, also auch das Höchste, das Du erreicht hast, ich wäre Dir ebenbürtig, alle alte und ewig neue Schande und Tyrannei wäre bloß noch Geschichte. Das wäre allerdings märchenhaft, aber darin liegt eben schon das Fragwürdige. Es ist zu viel, so viel kann nicht erreicht werden. Es ist so, wie wenn einer gefangen wäre und er hätte nicht nur die Absicht zu fliehen, was vielleicht erreichbar wäre, sondern auch noch und zwar gleichzeitig die Absicht, das Gefängnis in ein Lustschloß für sich umzubauen. Wenn er aber flieht, kann er nicht umbauen, und wenn er umbaut, kann er nicht fliehen. Wenn ich in dem besonderen Unglücksverhältnis, in welchem ich zu Dir stehe, selbständig werden will, muß ich etwas tun, was möglichst gar keine Beziehung zu Dir hat – das Heiraten ist zwar das Größte und gibt die ehrenvollste Selbständigkeit, aber es ist auch gleichzeitig in engster Beziehung zu Dir. Hier hinauskommen zu wollen, hat deshalb etwas von Wahnsinn, und jeder Versuch wird fast damit gestraft.
Gerade diese enge Beziehung lockt mich ja teilweise auch zum Heiraten. Ich denke mir diese Ebenbürtigkeit, die dann zwischen uns entstehen würde und die Du verstehen könntest wie keine andere, eben deshalb so schön, weil ich dann ein freier, dankbarer, schuldloser, aufrechter Sohn sein, Du ein unbedrückter, untyrannischer, mitfühlender, zufriedener Vater sein könntest. Aber zu dem Zweck müßte eben alles Geschehene ungeschehen gemacht, das heißt wir selbst ausgestrichen werden.
So wie wir aber sind, ist mir das Heiraten dadurch verschlossen, daß es gerade Dein eigenstes Gebiet ist. Manchmal stelle ich mir die Erdkarte ausgespannt und Dich quer über sie hin ausgestreckt vor. Und es ist mir dann, als kämen für mein Leben nur die Gegenden in Betracht, die Du enLiebster Vater,tweder nicht bedeckst oder die nicht in Deiner Reichweite liegen. Und das sind entsprechend der Vorstellung, die ich von Deiner Größe habe, nicht viele und nicht sehr trostreiche Gegenden und besonders die Ehe ist nicht darunter.
Schon dieser Vergleich beweist, daß ich keineswegs sagen will, Du hättest mich durch Dein Beispiel aus der Ehe, so etwa wie aus dem Geschäft, verjagt. Im Gegenteil, trotz aller fernen Ähnlichkeit. Ich hatte in Eurer Ehe eine in vielem mustergültige Ehe vor mir, mustergültig in Treue, gegenseitiger Hilfe, Kinderzahl, und selbst als dann die Kinder groß wurden und immer mehr den Frieden störten, blieb die Ehe als solche davon unberührt. Gerade an diesem Beispiel bildete sich vielleicht auch mein hoher Begriff von der Ehe; daß das Verlangen nach der Ehe ohnmächtig war, hatte eben andere Gründe. Sie lagen in Deinem Verhältnis zu den Kindern, von dem ja der ganze Brief handelt.
Es gibt eine Meinung, nach der die Angst vor der Ehe manchmal davon herrührt, daß man fürchtet, die Kinder würden einem später das heimzahlen, was man selbst an den eigenen Eltern gesündigt hat. Das hat, glaube ich, in meinem Fall keine sehr große Bedeutung, denn mein Schuldbewußtsein stammt ja eigentlich von Dir und ist auch zu sehr von seiner Einzigartigkeit durchdrungen, ja dieses Gefühl der Einzigartigkeit gehört zu seinem quälenden Wesen, eine Wiederholung ist unausdenkbar. Immerhin muß ich sagen, daß mir ein solcher stummer, dumpfer, trockener, verfallener Sohn unerträglich wäre, ich würde wohl, wenn keine andere Möglichkeit wäre, vor ihm fliehen, auswandern, wie Du es erst wegen meiner Heirat machen wolltest. Also mitbeeinflußt mag ich bei meiner Heiratsunfähigkeit auch davon sein.
Viel wichtiger aber ist dabei die Angst um mich. Das ist so zu verstehn: Ich habe schon angedeutet, daß ich im Schreiben und in dem, was damit zusammenhängt, kleine Selbständigkeitsversuche, Fluchtversuche mit allerkleinstem Erfolg gemacht, sie werden kaum weiterführen, vieles bestätigt mir das. Trotzdem ist es meine Pflicht oder vielmehr es besteht mein Leben darin, über ihnen zu wachen, keine Gefahr, die ich abwehren kann, ja keine Möglichkeit einer solcher Gefahr an sie herankommen zu lassen. Die Ehe ist die Möglichkeit einer solchen Gefahr, allerdings auch die Möglichkeit der größten Förderung, mir aber genügt, daß es die Möglichkeit einer Gefahr ist. Was würde ich dann anfangen, wenn es doch eine Gefahr wäre! Wie könnte ich in der Ehe weiterleben in dem vielleicht unbeweisbaren, aber jedenfalls unwiderleglichen Gefühl dieser Gefahr! Demgegenüber kann ich zwar schwanken, aber der schließliche Ausgang ist gewiß, ich muß verzichten. Der Vergleich von dem Sperling in der Hand und der Taube auf dem Dach paßt hier nur sehr entfernt. In der Hand habe ich nichts, auf dem Dach ist alles und doch muß ich – so entscheiden es die Kampfverhältnisse und die Lebensnot – das Nichts wählen. Ähnlich habe ich ja auch bei der Berufswahl wählen müssen.
Das wichtigste Ehehindernis aber ist die schon unausrottbare Überzeugung, daß zur Familienerhaltung und gar zu ihrer Führung alles das notwendig gehört, was ich an Dir erkannt habe, und zwar alles zusammen, Gutes und Schlechtes, so wie es organisch in Dir vereinigt ist, also Stärke und Verhöhnung des anderen, Gesundheit und eine gewisse Maßlosigkeit, Redebegabung und Unzulänglichkeit, Selbstvertrauen und Unzufriedenheit mit jedem anderen, Weltüberlegenheit und Tyrannei, Menschenkenntnis und Mißtrauen gegenüber den meisten, dann auch Vorzüge ohne jeden Nachteil wie Fleiß, Ausdauer, Geistesgegenwart, Unerschrockenheit. Von alledem hatte ich vergleichsweise fast nichts oder nur sehr wenig und damit wollte ich zu heiraten wagen, während ich doch sah, daß selbst Du in der Ehe schwer zu kämpfen hattest und gegenüber den Kindern sogar versagtest? Diese Frage stellte ich mir natürlich nicht ausdrücklich und beantworte sie nicht ausdrücklich, sonst hätte sich ja das gewöhnliche Denken der Sache bemächtigt und mir andere Männer gezeigt, welche anders sind als Du (um in der Nähe einen von Dir sehr verschiedenen zu nennen: Onkel Richard) und doch geheiratet haben und wenigstens darunter nicht zusammengebrochen sind, was schon sehr viel ist und mir reichlich genügt hätte. Aber diese Frage stellte ich eben nicht, sondern erlebte sie von Kindheit an. Ich prüfte mich ja nicht erst gegenüber der Ehe, sondern gegenüber jeder Kleinigkeit; gegenüber jeder Kleinigkeit überzeugtest Du mich durch Dein Beispiel und durch Deine Erziehung, so wie ich es zu beschreiben versucht habe, von meiner Unfähigkeit, und was bei jeder Kleinigkeit stimmte und Dir recht gab, mußte natürlich ungeheuerlich stimmen vor dem Größten, also vor der Ehe. Bis zu den Heiratsversuchen bin ich aufgewachsen etwa wie ein Geschäftsmann, der zwar mit Sorgen und schlimmen Ahnungen, aber ohne genaue Buchführung in den Tag hineinlebt. Er hat ein paar kleine Gewinne, die er infolge ihrer Seltenheit in seiner Vorstellung immerfort hätschelt und übertreibt, und sonst nur tägliche Verluste. Alles wird eingetragen, aber niemals bilanziert. Jetzt kommt der Zwang zur Bilanz, das heißt der Heiratsversuch. Und es ist bei den großen Summen, mit denen hier zu rechnen ist, so, als ob niemals auch nur der kleinste Gewinn gewesen wäre, alles eine einzige große Schuld. Und jetzt heirate, ohne wahnsinnig zu werden!
So endet mein bisheriges Leben mit Dir, und solche Aussichten trägt es in sich für die Zukunft.
Du könntest, wenn Du meine Begründung der Furcht, die ich vor Dir habe, überblickst, antworten: »Du behauptest, ich mache es mir leicht, wenn ich mein Verhältnis zu Dir einfach durch Dein Verschulden erkläre, ich aber glaube, daß Du trotz äußerlicher Anstrengung es Dir zumindest nicht schwerer, aber viel einträglicher machst. Zuerst lehnst auch Du jede Schuld und Verantwortung von Dir ab, darin ist also unser Verfahren das gleiche. Während ich aber dann so offen, wie ich es auch meine, die alleinige Schuld Dir zuschreibe, willst Du gleichzeitig ›übergescheit‹ und ›überzärtlich‹ sein und auch mich von jeder Schuld freisprechen. Natürlich gelingt Dir das letztere nur scheinbar (mehr willst Du ja auch nicht), und es ergibt sich zwischen den Zeilen trotz aller ›Redensarten‹ von Wesen und Natur und Gegensatz und Hilflosigkeit, daß eigentlich ich der Angreifer gewesen bin, während alles, was Du getrieben hast, nur Selbstwehr war. Jetzt hättest Du also schon durch Deine Unaufrichtigkeit genug erreicht, denn Du hast dreierlei bewiesen, erstens daß Du unschuldig bist, zweitens daß ich schuldig bin und drittens daß Du aus lauter Großartigkeit bereit bist, nicht nur mir zu verzeihn, sondern, was mehr und weniger ist, auch noch zu beweisen und es selbst glauben zu wollen, daß ich, allerdings entgegen der Wahrheit, auch unschuldig bin. Das könnte Dir jetzt schon genügen, aber es genügt Dir noch nicht. Du hast es Dir nämlich in den Kopf gesetzt, ganz und gar von mir leben zu wollen. Ich gebe zu, daß wir miteinander kämpfen, aber es gibt zweierlei Kampf. Den ritterlichen Kampf, wo sich die Kräfte selbständiger Gegner messen, jeder bleibt für sich, verliert für sich, siegt für sich. Und den Kampf des Ungeziefers, welches nicht nur sticht, sondern gleich auch zu seiner Lebenserhaltung das Blut saugt. Das ist ja der eigentliche Berufssoldat und das bist Du. Lebensuntüchtig bist Du; um es Dir aber darin bequem, sorgenlos und ohne Selbstvorwürfe einrichten zu können, beweist Du, daß ich alle Deine Lebenstüchtigkeit Dir genommen und in meine Taschen gesteckt habe. Was kümmert es Dich jetzt, wenn Du lebensuntüchtig bist, ich habe ja die Verantwortung. Du aber streckst Dich ruhig aus und läßt Dich, körperlich und geistig, von mir durchs Leben schleifen. Ein Beispiel: Als Du letzthin heiraten wolltest, wolltest Du, das gibst Du ja in diesem Brief zu, gleichzeitig nicht heiraten, wolltest aber, um Dich nicht anstrengen zu müssen, daß ich Dir zum Nichtheiraten verhelfe, indem ich wegen der ›Schande‹, die die Verbindung meinem Namen machen würde, Dir diese Heirat verbiete. Das fiel mir nun aber gar nicht ein. Erstens wollte ich Dir hier wie auch sonst nie ›in Deinem Glück hinderlich sein‹, und zweitens will ich niemals einen derartigen Vorwurf von meinem Kind zu hören bekommen. Hat mir aber die Selbstüberwindung, mit der ich Dir die Heirat freistellte, etwas geholfen? Nicht das Geringste. Meine Abneigung gegen die Heirat hätte sie nicht verhindert, im Gegenteil, es wäre an sich noch ein Anreiz mehr für Dich gewesen, das Mädchen zu heiraten, denn der ›Fluchtversuch‹, wie Du Dich ausdrückst, wäre ja dadurch vollkommen geworden. Und meine Erlaubnis zur Heirat hat Deine Vorwürfe nicht verhindert, denn Du beweist ja, daß ich auf jeden Fall an Deinem Nichtheiraten schuld bin. Im Grunde aber hast Du hier und in allem anderen für mich nichts anderes bewiesen, als daß alle meine Vorwürfe berechtigt waren und daß unter ihnen noch ein besonders berechtigter Vorwurf gefehlt hat, nämlich der Vorwurf der Unaufrichtigkeit, der Liebedienerei, des Schmarotzertums. Wenn ich nicht sehr irre, schmarotzest Du an mir auch noch mit diesem Brief als solchem.«
Darauf antworte ich, daß zunächst dieser ganze Einwurf, der sich zum Teil auch gegen Dich kehren läßt, nicht von Dir stammt, sondern eben von mir. So groß ist ja nicht einmal Dein Mißtrauen gegen andere, wie mein Selbstmißtrauen, zu dem Du mich erzogen hast. Eine gewisse Berechtigung des Einwurfes, der ja auch noch an sich zur Charakterisierung unseres Verhältnisses Neues beiträgt, leugne ich nicht. So können natürlich die Dinge in Wirklichkeit nicht aneinanderpassen, wie die Beweise in meinem Brief, das Leben ist mehr als ein Geduldspiel; aber mit der Korrektur, die sich durch diesen Einwurf ergibt, einer Korrektur, die ich im einzelnen weder ausführen kann noch will, ist meiner Meinung nach doch etwas der Wahrheit so sehr Angenähertes erreicht, daß es uns beide ein wenig beruhigen und Leben und Sterben leichter machen kann.
Franz
Franz Kafka
(1883-1924)
Brief an den Vater
fleursdumal.nl magazine
More in: Franz Kafka, Kafka, Franz, Kafka, Franz
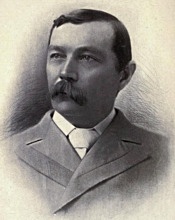 The Case of Lady Sannox
The Case of Lady Sannox
by Arthur Conan Doyle
The relations between Douglas Stone and the notorious Lady Sannox were very well known both among the fashionable circles of which she was a brilliant member, and the scientific bodies which numbered him among their most illustrious confreres. There was naturally, therefore, a very widespread interest when it was announced one morning that the lady had absolutely and for ever taken the veil, and that the world would see her no more. When, at the very tail of this rumour, there came the assurance that the celebrated operating surgeon, the man of steel nerves, had been found in the morning by his valet, seated on one side of his bed, smiling pleasantly upon the universe, with both legs jammed into one side of his breeches and his great brain about as valuable as a cap full of porridge, the matter was strong enough to give quite a little thrill of interest to folk who had never hoped that their jaded nerves were capable of such a sensation.
Douglas Stone in his prime was one of the most remarkable men in England. Indeed, he could hardly be said to have ever reached his prime, for he was but nine-and-thirty at the time of this little incident. Those who knew him best were aware that, famous as he was as a surgeon, he might have succeeded with even greater rapidity in any of a dozen lines of life. He could have cut his way to fame as a soldier, struggled to it as an explorer, bullied for it in the courts, or built it out of stone and iron as an engineer. He was born to be great, for he could plan what another man dare not do, and he could do what another man dare not plan. In surgery none could follow him. His nerve, his judgment, his intuition, were things apart. Again and again his knife cut away death, but grazed the very springs of life in doing it, until his assistants were as white as the patient. His energy, his audacity, his full-blooded self-confidence—does not the memory of them still linger to the south of Marylebone Road and the north of Oxford Street?
His vices were as magnificent as his virtues, and infinitely more picturesque. Large as was his income, and it was the third largest of all professional men in London, it was far beneath the luxury of his living. Deep in his complex nature lay a rich vein of sensualism, at the sport of which he placed all the prizes of his life. The eye, the ear, the touch, the palate—all were his masters. The bouquet of old vintages, the scent of rare exotics, the curves and tints of the daintiest potteries of Europe—it was to these that the quick-running stream of gold was transformed. And then there came his sudden mad passion for Lady Sannox, when a single interview with two challenging glances and a whispered word set him ablaze. She was the loveliest woman in London, and the only one to him. He was one of the handsomest men in London, but not the only one to her. She had a liking for new experiences, and was gracious to most men who wooed her. It may have been cause or it may have been effect that Lord Sannox looked fifty, though he was but six-and-thirty.
He was a quiet, silent, neutral-tinted man, this lord, with thin lips and heavy eyelids, much given to gardening, and full of home-like habits. He had at one time been fond of acting, had even rented a theatre in London, and on its boards had first seen Miss Marion Dawson, to whom he had offered his hand, his title, and the third of a county. Since his marriage this early hobby had become distasteful to him. Even in private theatricals it was no longer possible to persuade him to exercise the talent which he had often shown that he possessed. He was happier with a spud and a watering-can among his orchids and chrysanthemums.
It was quite an interesting problem whether he was absolutely devoid of sense, or miserably wanting in spirit. Did he know his lady’s ways and condone them, or was he a mere blind, doting fool? It was a point to be discussed over the teacups in snug little drawing-rooms, or with the aid of a cigar in the bow windows of clubs. Bitter and plain were the comments among men upon his conduct. There was but one who had a good word to say for him, and he was the most silent member in the smoking-room. He had seen him break in a horse at the university, and it seemed to have left an impression upon his mind.
But when Douglas Stone became the favourite, all doubts as to Lord Sannox’s knowledge or ignorance were set for ever at rest. There, was no subterfuge about Stone. In his high-handed, impetuous fashion, he set all caution and discretion at defiance. The scandal became notorious. A learned body intimated that his name had been struck from the list of its vice-presidents. Two friends implored him to consider his professional credit. He cursed them all three, and spent forty guineas on a bangle to take with him to the lady. He was at her house every evening, and she drove in his carriage in the afternoons. There was not an attempt on either side to conceal their relations; but there came at last a little incident to interrupt them.
It was a dismal winter’s night, very cold and gusty, with the wind whooping in the chimneys and blustering against the window-panes. A thin spatter of rain tinkled on the glass with each fresh sough of the gale, drowning for the instant the dull gurgle and drip from the eves. Douglas Stone had finished his dinner, and sat by his fire in the study, a glass of rich port upon the malachite table at his elbow. As he raised it to his lips, he held it up against the lamplight, and watched with the eye of a connoisseur the tiny scales of beeswing which floated in its rich ruby depths. The fire, as it spurted up, threw fitful lights upon his bold, clear-cut face, with its widely-opened grey eyes, its thick and yet firm lips, and the deep, square jaw, which had something Roman in its strength and its animalism. He smiled from time to time as he nestled back in his luxurious chair. Indeed, he had a right to feel well pleased, for, against the advice of six colleagues, he had performed an operation that day of which only two cases were on record, and the result had been brilliant beyond all expectation. No other man in London would have had the daring to plan, or the skill to execute, such a heroic measure.
But he had promised Lady Sannox to see her that evening and it was already half-past eight. His hand was outstretched to the bell to order the carriage when he heard the dull thud of the knocker. An instant later there was the shuffling of feet in the hall, and the sharp closing of a door.
“A patient to see you, sir, in the consulting-room, said the butler.
“About himself?”
“No, sir; I think he wants you to go out.”
“It is too late,” cried Douglas Stone peevishly. “I won’t go.”
“This is his card, sir.”
The butler presented it upon the gold salver which had been given to his master by the wife of a Prime Minister.
“‘Hamil Ali, Smyrna.’ Hum! The fellow is a Turk, I suppose.”
“Yes, sir. He seems as if he came from abroad, sir. And he’s in a terrible way.”
“Tut, tut! I have an engagement. I must go somewhere else. But I’ll see him. Show him in here, Pim.”
A few moments later the butler swung open the door and ushered in a small and decrepit man, who walked with a bent back and with the forward push of the face and blink of the eyes which goes with extreme short sight. His face was swarthy, and his hair and beard of the deepest black. In one hand he held a turban of white muslin striped with red, in the other a small chamois leather bag.
“Good-evening,” said Douglas Stone, when the butler had closed the door. “You speak English, I presume?”
“Yes, sir. I am from Asia Minor, but I speak English when I speak slow.”
“You wanted me to go out, I understand?”
“Yes, sir. I wanted very much that you should see my wife.”
“I could come in the morning, but I have an engagement which prevents me from seeing your wife to-night.”
The Turk’s answer was a singular one. He pulled the string which closed the mouth of the chamois leather bag, and poured a flood of gold on to the table.
“There are one hundred pounds there,” said he, “and I promise you that it will not take you an hour. I have a cab ready at the door.”
Douglas Stone glanced at his watch. An hour would not make it too late to visit Lady Sannox. He had been there later. And the fee was an extraordinarily high one. He had been pressed by his creditors lately, and he could not afford to let such a chance pass. He would go.
“What is the case?” he asked.
“Oh, it is so sad a one! So sad a one! You have not, perhaps, heard of the daggers of the Almohades?”
“Never.”
“Ah, they are Eastern daggers of a great age and of a singular shape, with the hilt like what you call a stirrup. I am a curiosity dealer, you understand, and that is why I have come to England from Smyrna, but next week I go back once more. Many things I brought with me, and I have a few things left, but among them, to my sorrow, is one of these daggers.”
“You will remember that I have an appointment, sir,” said the surgeon, with some irritation. “Pray confine yourself to the necessary details.”
“You will see that it is necessary. To-day my wife fell down in a faint in the room in which I keep my wares, and she cut her lower lip upon this cursed dagger of Almohades.”
“I see,” said Douglas Stone, rising. “And you wish me to dress the wound?”
“No, no, it is worse than that.”
“What then?”
“These daggers are poisoned.”
“Poisoned!”
“Yes, and there is no man, East or West, who can tell now what is the poison or what the cure. But all that is known I know, for my father was in this trade before me, and we have had much to do with these poisoned weapons.”
“What are the symptoms?”
“Deep sleep, and death in thirty hours.”
“And you say there is no cure. Why then should you pay me this considerable fee?”
“No drug can cure, but the knife may.”
“And how?”
“The poison is slow of absorption. It remains for hours in the wound.”
“Washing, then, might cleanse it?”
“No more than in a snake-bite. It is too subtle and too deadly.”
“Excision of the wound, then?”
“That is it. If it be on the finger, take the finger off. So said my father always. But think of where this wound is, and that it is my wife. It is dreadful!”
But familiarity with such grim matters may take the finer edge from a man’s sympathy. To Douglas Stone this was already an interesting case, and he brushed aside as irrelevant the feeble objections of the husband.
“It appears to be that or nothing,” said he brusquely. “It is better to lose a lip than a life.”
“Ah, yes, I know that you are right. Well, well, it is kismet, and must be faced. I have the cab, and you will come with me and do this thing.”
Douglas Stone took his case of bistouries from a drawer, and placed it with a roll of bandage and a compress of lint in his pocket. He must waste no more time if he were to see Lady Sannox.
“I am ready,” said he, pulling on his overcoat. “Will you take a glass of wine before you go out into this cold air?”
His visitor shrank away, with a protesting hand upraised.
“You forget that I am a Mussulman, and a true follower of the Prophet,” said he. “But tell me what is the bottle of green glass which you have placed in your pocket?”
“It is chloroform.”
“Ah, that also is forbidden to us. It is a spirit, and we make no use of such things.”
“What! You would allow your wife to go through an operation without an anaesthetic?”
“Ah! she will feel nothing, poor soul. The deep sleep has already come on, which is the first working of the poison. And then I have given her of our Smyrna opium. Come, sir, for already an hour has passed.”
As they stepped out into the darkness, a sheet of rain was driven in upon their faces, and the hall lamp, which dangled from the arm of a marble caryatid, went out with a fluff. Pim, the butler, pushed the heavy door to, straining hard with his shoulder against the wind, while the two men groped their way towards the yellow glare which showed where the cab was waiting. An instant later they were rattling upon their journey.
“Is it far?” asked Douglas Stone.
“Oh, no. We have a very little quiet place off the Euston Road.”
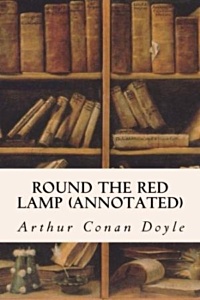 The surgeon pressed the spring of his repeater and listened to the little tings which told him the hour. It was a quarter past nine. He calculated the distances, and the short time which it would take him to perform so trivial an operation. He ought to reach Lady Sannox by ten o’clock. Through the fogged windows he saw the blurred gas-lamps dancing past, with occasionally the broader glare of a shop front. The rain was pelting and rattling upon the leathern top of the carriage and the wheels swashed as they rolled through puddle and mud. Opposite to him the white headgear of his companion gleamed faintly through the obscurity. The surgeon felt in his pockets and arranged his needles, his ligatures and his safety-pins, that no time might be wasted when they arrived. He chafed with impatience and drummed his foot upon the floor.
The surgeon pressed the spring of his repeater and listened to the little tings which told him the hour. It was a quarter past nine. He calculated the distances, and the short time which it would take him to perform so trivial an operation. He ought to reach Lady Sannox by ten o’clock. Through the fogged windows he saw the blurred gas-lamps dancing past, with occasionally the broader glare of a shop front. The rain was pelting and rattling upon the leathern top of the carriage and the wheels swashed as they rolled through puddle and mud. Opposite to him the white headgear of his companion gleamed faintly through the obscurity. The surgeon felt in his pockets and arranged his needles, his ligatures and his safety-pins, that no time might be wasted when they arrived. He chafed with impatience and drummed his foot upon the floor.
But the cab slowed down at last and pulled up. In an instant Douglas Stone was out, and the Smyrna merchant’s toe was at his very heel.
“You can wait,” said he to the driver.
It was a mean-looking house in a narrow and sordid street. The surgeon, who knew his London well, cast a swift glance into the shadows, but there was nothing distinctive—no shop, no movement, nothing but a double line of dull, flat-faced houses, a double stretch of wet flagstones which gleamed in the lamplight, and a double rush of water in the gutters which swirled and gurgled towards the sewer gratings. The door which faced them was blotched and discoloured, and a faint light in the fan pane above it served to show the dust and the grime which covered it. Above, in one of the bedroom windows, there was a dull yellow glimmer. The merchant knocked loudly, and, as he turned his dark face towards the light, Douglas Stone could see that it was contracted with anxiety. A bolt was drawn, and an elderly woman with a taper stood in the doorway, shielding the thin flame with her gnarled hand.
“Is all well?” gasped the merchant.
“She is as you left her, sir.”
“She has not spoken?”
“No; she is in a deep sleep.”
The merchant closed the door, and Douglas Stone walked down the narrow passage, glancing about him in some surprise as he did so. There was no oilcloth, no mat, no hat-rack. Deep grey dust and heavy festoons of cobwebs met his eyes everywhere. Following the old woman up the winding stair, his firm footfall echoed harshly through the silent house. There was no carpet.
The bedroom was on the second landing. Douglas Stone followed the old nurse into it, with the merchant at his heels. Here, at least, there was furniture and to spare. The floor was littered and the corners piled with Turkish cabinets, inlaid tables, coats of chain mail, strange pipes, and grotesque weapons. A single small lamp stood upon a bracket on the wall. Douglas Stone took it down, and picking his way among the lumber, walked over to a couch in the corner, on which lay a woman dressed in the Turkish fashion, with yashmak and veil. The lower part of the face was exposed, and the surgeon saw a jagged cut which zigzagged along the border of the under lip.
“You will forgive the yashmak,” said the Turk. “You know our views about woman in the East.”
But the surgeon was not thinking about the yashmak. This was no longer a woman to him. It was a case. He stooped and examined the wound carefully.
“There are no signs of irritation,” said he. “We might delay the operation until local symptoms develop.”
The husband wrung his hands in incontrollable agitation.
“Oh! sir, sir!” he cried. “Do not trifle. You do not know. It is deadly. I know, and I give you my assurance that an operation is absolutely necessary. Only the knife can save her.”
“And yet I am inclined to wait,” said Douglas Stone.
“That is enough!” the Turk cried, angrily. “Every minute is of importance, and I cannot stand here and see my wife allowed to sink. It only remains for me to give you my thanks for having come, and to call in some other surgeon before it is too late.”
Douglas Stone hesitated. To refund that hundred pounds was no pleasant matter. But of course if he left the case he must return the money. And if the Turk were right and the woman died, his position before a coroner might be an embarrassing one.
“You have had personal experience of this poison?” he asked.
“I have.”
“And you assure me that an operation is needful.”
“I swear it by all that I hold sacred.”
“The disfigurement will be frightful.”
“I can understand that the mouth will not be a pretty one to kiss.”
Douglas Stone turned fiercely upon the man. The speech was a brutal one. But the Turk has his own fashion of talk and of thought, and there was no time for wrangling. Douglas Stone drew a bistoury from his case, opened it and felt the keen straight edge with his forefinger. Then he held the lamp closer to the bed. Two dark eyes were gazing up at him through the slit in the yashmak. They were all iris, and the pupil was hardly to be seen.
“You have given her a very heavy dose of opium.”
“Yes, she has had a good dose.”
He glanced again at the dark eyes which looked straight at his own. They were dull and lustreless, but, even as he gazed, a little shifting sparkle came into them, and the lips quivered.
“She is not absolutely unconscious,” said he.
“Would it not be well to use the knife while it would be painless?”
The same thought had crossed the surgeon’s mind. He grasped the wounded lip with his forceps, and with two swift cuts he took out a broad V-shaped piece. The woman sprang up on the couch with a dreadful gurgling scream. Her covering was torn from her face. It was a face that he knew. In spite of that protruding upper lip and that slobber of blood, it was a face that he knew. She kept on putting her hand up to the gap and screaming. Douglas Stone sat down at the foot of the couch with his knife and his forceps. The room was whirling round, and he had felt something go like a ripping seam behind his ear. A bystander would have said that his face was the more ghastly of the two. As in a dream, or as if he had been looking at something at the play, he was conscious that the Turk’s hair and beard lay upon the table, and that Lord Sannox was leaning against the wall with his hand to his side, laughing silently. The screams had died away now, and the dreadful head had dropped back again upon the pillow, but Douglas Stone still sat motionless, and Lord Sannox still chuckled quietly to himself.
“It was really very necessary for Marion, this operation,” said he, “not physically, but morally, you know, morally.”
Douglas Stone stooped forwards and began to play with the fringe of the coverlet. His knife tinkled down upon the ground, but he still held the forceps and something more.
“I had long intended to make a little example,” said Lord Sannox, suavely. “Your note of Wednesday miscarried, and I have it here in my pocket-book. I took some pains in carrying out my idea. The wound, by the way, was from nothing more dangerous than my signet ring.”
He glanced keenly at his silent companion, and cocked the small revolver which he held in his coat pocket. But Douglas Stone was still picking at the coverlet.
“You see you have kept your appointment after all,” said Lord Sannox.
And at that Douglas Stone began to laugh. He laughed long and loudly. But Lord Sannox did not laugh now. Something like fear sharpened and hardened his features. He walked from the room, and he walked on tiptoe. The old woman was waiting outside.
“Attend to your mistress when she awakes,” said Lord Sannox.
Then he went down to the street. The cab was at the door, and the driver raised his hand to his hat.
“John,” said Lord Sannox, “you will take the doctor home first. He will want leading downstairs, I think. Tell his butler that he has been taken ill at a case.”
“Very good, sir.”
“Then you can take Lady Sannox home.”
“And how about yourself, sir?”
“Oh, my address for the next few months will be Hotel di Roma, Venice. Just see that the letters are sent on. And tell Stevens to exhibit all the purple chrysanthemums next Monday and to wire me the result.”
Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930)
Round the Red Lamp: Being Facts and Fancies of Medical Life
The Case of Lady Sannox (#09)
fleursdumal.nl magazine
More in: Doyle, Arthur Conan, Doyle, Arthur Conan, DRUGS & DISEASE & MEDICINE & LITERATURE, Round the Red Lamp
 Dan dada doe uw werk!
Dan dada doe uw werk!
Avant-gardistische poëzie uit de Lage Landen
Redactie: Geert Buelens, Hubert van den Berg
‘Dan dada doe uw werk!’ Met deze woorden besluit I.K. Bonset in 1921 in De Stijl een tirade tegen pogingen om ‘de kanselliteratuur van vóór ’80’ in het interbellum nieuw leven in te blazen. Of dada het ‘predikantenpathos’ inderdaad wist uit te drijven uit de Nederlandstalige literatuur, valt te betwijfelen. Wel lieten dada en andere avant-gardistische ‘ismen’ hun onmiskenbare sporen na in de Nederlandstalige poëzie.
In Dan dada doe uw werk! presenteren samenstellers Hubert van den Berg en Geert Buelens een dwarsdoorsnede van de poëtische avant-garde in de vroege twintigste eeuw in Nederland en Vlaanderen. De bloemlezing bevat werk van onder anderen Piet Mondriaan, I.K. Bonset, Paul van Ostaijen, Herman van den Bergh, Hendrik de Vries, H. Marsman, Pierre Kemp, Kurt Schwitters, Antony Kok, Victor J. Brunclair, Til Brugman, Gaston Burssens, A.C. Willink, Michel Seuphor en H.N. Werkman.
Dan dada doe uw werk! is het laatste deel in de Dada-reeks van Uitgeverij Vantilt. Eerder verschenen Tenderenda de Fantast van Hugo Ball, In den beginne was Dada van Raoul Hausmann, 7 dadamanifesten van Tristan Tzara, En Avant dada van Richard Huelsenbeck, Een avond in Cabaret Voltaire van Hans Arp e.a., Jezus Christus Quibus van Francis Picabia en Apologie van de luiheid en Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt & Bar Nicanor van Clément Pansaers.
Geert Buelens, Hubert van den Berg
(Redactie)
Vormgever: Martien Frijns
ISBN 9789460041617
paperback
15 x 22 cm
248 pagina’s
Uitgeverij Vantilt
€ 19,95
fleursdumal.nl magazine
More in: - Book News, Antony Kok, Antony Kok, Baargeld, Johannes Theodor, Ball, Hugo, Cendrars, Blaise, Dada, DADA, Dadaïsme, De Stijl, Doesburg, Theo van, Ernst Jandl, Essays about Van Doesburg, Kok, Mondriaan, Schwitters, Milius & Van Moorsel, Evert en Thijs Rinsema, EXPRESSIONISM, DADA & DE STIJL, SURREALISM, Freytag-Loringhoven, Elsa von, Jandl, Ernst, Kok, Antony, Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Ostaijen, Paul van, Pansaers, Clément, Paul van Ostaijen, Piet Mondriaan, Schwitters, Kurt, Theo van Doesburg, Theo van Doesburg, Theo van Doesburg (I.K. Bonset), Tzara, Tristan, Werkman, Hendrik Nicolaas
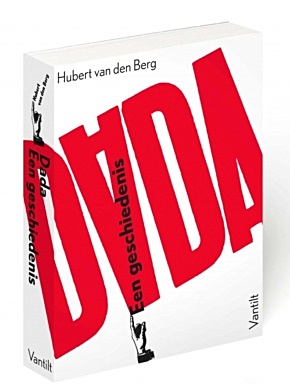 Dada
Dada
Een geschiedenis
Auteur: Hubert van den Berg
Dada. Een geschiedenis beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de internationale dadabeweging, zoals die zich manifesteerde in onder andere Zürich, Berlijn en Parijs. Bijzondere aandacht is er voor dada-Nederland en dada-België en de belangrijkste hoofdrolspelers daar: Theo van Doesburg/I.K. Bonset, H.N. Werkman, Piet Mondriaan, Clément Pansaers en Paul van Ostaijen.
Dada wordt vaak een antibeweging genoemd. Dada. Een geschiedenis herziet dit eenzijdige, negatieve beeld. In werkelijkheid was dada zowel een synthese van vooroorlogse avantgardistische ‘ismen’ – kubisme, futurisme en expressionisme –, als de opmaat tot het surrealisme en constructivisme. Dada is een cruciale etappe in de ontwikkeling van de moderne kunst en literatuur van de twintigste eeuw, waarvan de echo nog altijd klinkt.
Dada. Een geschiedenis is rijk in kleur geïllustreerd. Een kroniek van de belangrijkste dadakunstenaars, -kunstwerken, -evenementen en -gebeurtenissen completeert het boek.
Hubert van den Berg:
Dada. Een geschiedenis
Vormgever: Martien Frijns
ISBN 9789075697971,
paperback
17 x 22 cm
geïllustreerd
304 pagina’s
Uitgeverij Vantilt
€ 29,95
fleursdumal.nl magazine
More in: - Book News, Antony Kok, Art & Literature News, Baargeld, Johannes Theodor, Ball, Hugo, Dada, DADA, Dadaïsme, DANCE & PERFORMANCE, De Stijl, Essays about Van Doesburg, Kok, Mondriaan, Schwitters, Milius & Van Moorsel, Evert en Thijs Rinsema, Freytag-Loringhoven, Elsa von, Kok, Antony, Kurt Schwitters, LITERARY MAGAZINES, MUSIC, Ostaijen, Paul van, Pansaers, Clément, Piet Mondriaan, Satie, Erik, Schwitters, Kurt, THEATRE, Theo van Doesburg, Theo van Doesburg, Tzara, Tristan, Werkman, Hendrik Nicolaas

TILT Festival
29 maart – 1 april 2017
Tilburg
de eerste namen:
Yves Petry,
Astrid Roemer,
De Optimist
tiltfestival.nu
fleursdumal.nl magazine
More in: - Book News, Art & Literature News, AUDIO, CINEMA, RADIO & TV, DANCE & PERFORMANCE, MUSIC, THEATRE, Tilt Festival Tilburg

Humor en poëzie? ”Jawel”, zegt Jules Deelder (Rotterdam-Overschie, 1944), die het Poëziegeschenk 2017 zal schrijven. Met het thema humor in de Poëzieweek 2017 komt er aandacht voor gedichten die op de lachspieren werken, uit hilariteit, herkenbaarheid of uit ironie. Humor is in Deelders poëzie in ieder geval geen curiosum. Deze Nederlandse dichter van een omvangrijk oeuvre staat in binnen- en buitenland bekend om zijn memorabele performances, waarbij de Beat Generation nooit veraf lijkt.
Aan de vooravond van de Poëzieweek wordt in Nederland voor de 23ste keer de VSB Poëzieprijs uitgereikt en in Vlaanderen de Herman de Coninckprijs. De Poëzieweek start op donderdag 26 januari in Vlaanderen en Nederland met Gedichtendag en loopt t/m woensdag 1 februari; de prijsuitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd. Tijdens de Poëzieweek krijgen de klanten van de boekhandel bij aankoop van € 12,50 aan poëzie het Poëziegeschenk cadeau.
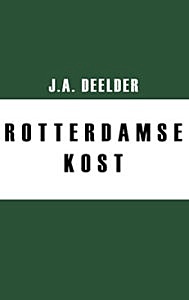 Gedichten worden in onze contreien eerder met ernst dan met humor geassocieerd. Het verdriet is eindeloos en de liefde hopeloos. Toch wordt er ook heel wat afgelachen in poëtenland. Soms is er de luide bulderlach bij een kolderiek nonsensgedicht, vaak is er ook een grijns van herkenning. De verwarrende situatie die de dichter beschrijft, hebben we zelf allemaal ook meegemaakt. Humor in poëzie kan ook wat ongemakkelijk zijn: valt hier wel om te lachen? Dichters gebruiken humor ook in de vorm van ironie of spot om een maatschappelijke wantoestand aan te klagen. Humor is bovenal een manier om met de meerduidigheid van de dingen om te gaan en dat is bij poëzie niet anders…
Gedichten worden in onze contreien eerder met ernst dan met humor geassocieerd. Het verdriet is eindeloos en de liefde hopeloos. Toch wordt er ook heel wat afgelachen in poëtenland. Soms is er de luide bulderlach bij een kolderiek nonsensgedicht, vaak is er ook een grijns van herkenning. De verwarrende situatie die de dichter beschrijft, hebben we zelf allemaal ook meegemaakt. Humor in poëzie kan ook wat ongemakkelijk zijn: valt hier wel om te lachen? Dichters gebruiken humor ook in de vorm van ironie of spot om een maatschappelijke wantoestand aan te klagen. Humor is bovenal een manier om met de meerduidigheid van de dingen om te gaan en dat is bij poëzie niet anders…
J.A. Deelder zette zijn eerste stappen in zijn carrière als performer in 1966. Na zijn poëziedebuut Gloria Satoria bij De Bezige Bij volgden nog vele bundels met als meest recente publicaties Tussentijds (2008), Ruisch (2011), Het graf van Descartes (2013) en Dag en nacht (2014). In zijn vaak absurdistische, maar steeds glasheldere poëzie wordt de jazz haast tastbaar. De onderwerpen die Deelder aansnijdt zijn de Tweede Wereldoorlog, Duitsland, Rotterdam, jazz en het leven van Deelder zelf. In 1982 debuteerde Deelder als prozaïst met Schöne Welt. Hierna verschenen een groot aantal verhalenbundels en gelegenheidsuitgaven waaronder Deelderama (2001), Swingkoning (2006) en Deelder lacht (2007). Deelder ontving voor zijn gehele oeuvre de Anna Blaman Prijs (1988), de Johnny Van Doorn-prijs voor de gesproken letteren (1999), en de Tollensprijs (2005). In 2005 mocht hij ook een Edison voor zijn cd Deelder blijft draaien in ontvangst nemen. 
De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking van Stichting Poetry International, Poëziecentrum, Iedereen Leest Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland, Awater, Poëzieclub, Het Literatuurhuis, Wintertuin, SLAG, Taalunie, SSS, het Nederlands Letterenfonds, Vlaams Fonds voor de Letteren, Turing Foundation, VSBfonds, Boek.be en de CPNB. Met de bundeling van deze activiteiten willen de organisatoren een groter bereik creëren voor poëzie.
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive C-D, Art & Literature News, Jules Deelder, LIGHT VERSE, Literary Events, Poëzieweek
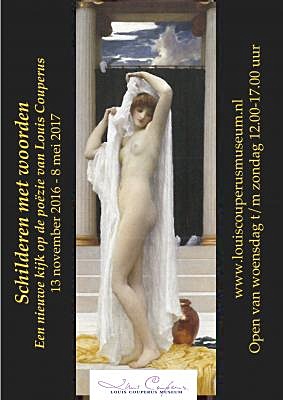 Nieuwe tentoonstelling Schilderen met woorden. Een nieuwe kijk op de poëzie van Louis Couperus. 13 november 2016 – 8 mei 2017 in het Louis Couperus Museum.
Nieuwe tentoonstelling Schilderen met woorden. Een nieuwe kijk op de poëzie van Louis Couperus. 13 november 2016 – 8 mei 2017 in het Louis Couperus Museum.
Gedurende een groot deel van zijn leven (om precies te zijn 25 jaar) heeft Louis Couperus poëzie geschreven. Tot nu toe is er te weinig aandacht geschonken aan dit onderwerp.
Deze winter visualiseert het Louis Couperus Museum de dichtkunst van de Haagse schrijver door middel van afbeeldingen en beeldhouwwerk waardoor de schrijver was geïnspireerd.
Tentoonstelling
Aan de wanden worden representatieve gedichten of citaten daaruit groot weer gegeven, op textiel afgedrukt. Bij elk fragment komt een afbeelding te hangen die inhoudelijk in verband staat met het betreffende gedicht. Reproducties van schilderijen – in een enkel geval zelfs een beeldhouwwerk – hebben Couperus soms regelrecht tot voorbeeld gediend. Ook de doorwerking van zijn poëzie in zijn proza komt aan bod. Op de televisiemonitor is een voordracht van zijn dichtkunst door acteur Joop Keesmaat te zien en te horen.
De expositie is gecentreerd rond 5 thema’s uit Couperus’ poëzie. Allereerst de figuur van Petrarca die hem de Laura-cyclus in gaf. Ten tweede de salon-schilderkunst uit de negentiende eeuw en daarmee samenhangend gedichten waarin Couperus bijna letterlijk ‘met woorden schildert’. Vervolgens het beeld Alba van de Friese beeldhouwer Pier Pander, dat Couperus in het gelijknamige sonnet bezong. Dan de wereld van de Arthurlegenden die hem zo boeide, en de door Italië geïnspireerde gedichten. De ‘aardse Couperus’ (Arjan Peters) komt in de ‘sonnettenroman’ Endymion aan bod. Hierin vereenzelvigt Couperus zich met een volksjongen die in de klassieke metropool Alexandrië allerlei avonturen beleeft. Dit wordt op eigentijdse wijze gevisualiseerd door een stripverhaal van de hand van Mees Arnzt, een student van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.
Verantwoording
De tentoonstelling wordt ingericht door gastconservator Frans van der Linden, medewerker van het Louis Couperus Museum, winnaar van de Couperuspenning en samensteller van het boekje O gouden, stralenshelle fantazie! Bloemlezing uit de poëzie van Louis Couperus (in de Prominentreeks van Uitgeverij Tiem, 2015).
De expositie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
schilderen met woorden.
een nieuwe kijk op de poëzie van Couperus
13 november 2016 – 8 mei 2017
Louis Couperus Museum
Javastraat 17
2585 AB Den Haag
070-3640653
info@louiscouperusmuseum.nl
Openingstijden
Woensdag t/m zondag 12.00-17.00 uur
Voor groepen ook op afspraak
Het gehele jaar door geopend, met uitzondering van 1ste en 2de Kerstdag en Nieuwjaarsdag
Toegankelijk voor gehandicapten
# Meer informatie op website van het Couperus Museum
fleursdumal.nl magazine
More in: Archive C-D, Archive C-D, Art & Literature News, DICTIONARY OF IDEAS, Literary Events, Louis Couperus, Museum of Literary Treasures
 Ben jij het poëzietalent van het jaar 2017?
Ben jij het poëzietalent van het jaar 2017?
Jouw gedicht in een dichtbundel? Dat kan! Doe mee aan de dichtwedstrijd Doe Maar Dicht Maar. Je hoeft geen doorgewinterd dichter te zijn om mee te doen. Je hoeft ook geen ‘klassiek’ gedicht te schrijven; een rap of een songtekst mag ook! Laat dus vooral je fantasie de vrije loop.
Poëziepaleis zoekt talent!
Kun jij goed schrijven? Ben jij creatief met woorden en heb je gevoel voor dichten, rappen of songteksten schrijven? Doe dan gauw mee met de dichtwedstrijd Doe Maar Dicht Maar. De honderd beste gedichten winnen een plekje in een mooie dichtbundel!
Hoe kun je meedoen?
Stuur voor 5 februari 2017 maximaal 3 gedichten in van elk maximaal 24 regels via het wedstrijdformulier. Vanzelfsprekend schrijf jij deze gedichten zelf; plagiaat is verboden! Omdat er duizenden gedichten worden ingestuurd, krijgen alleen de honderd winnaars begin mei 2016 bericht. De uitslag komt half mei op de website te staan.
 Wanneer mag je meedoen?
Wanneer mag je meedoen?
– Je bent 12 t/m 18 jaar;
– Je spreekt en schrijft Nederlands;
– Je zit op het VMBO/ Havo/ VWO/ ROC of MBO;
– Je zit op de eerste t/m de derde graad van het secundair onderwijs in België.
Wat kun je winnen?
Van de duizenden inzendingen worden 100 gedichten gekozen die een plekje in de dichtbundel Doe Maar Dicht Maar 2015/2016 krijgen. De tien allerbeste dichters, vijf winnaars uit de leeftijdscategorie 12 t/m 14 jaar en vijf winnaars uit de leeftijdscategorie 15 t/m 18 jaar, krijgen een uniek cadeau met hun gedicht erop. De winnaars uit deze categorieën winnen een hoofdprijs!
Wil je tips voor het schrijven van gedichten? Neem dan een kijkje bij Tips & Inspiratie.
# Meer te vinden op de website van het poëziepaleis
fleursdumal.nl magazine
More in: - Book Lovers, Art & Literature News, Children's Poetry, MODERN POETRY, POETRY ARCHIVE
 Kinderen en poëzie 2017
Kinderen en poëzie 2017
Kinderen en Poëzie is een landelijke dichtwedstrijd voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die het leuk vinden om gedichten te schrijven. Je kunt deelnemen via school, maar je kunt ook thuis of op de BSO een gedicht schrijven en dat insturen. Vul het wedstrijdformulier in of stuur je gedicht per post. Vraag je ouders, juf of meester om je te helpen als je het niet snapt.
Wanneer mag je meedoen?
– Als je 6 t/m 12 jaar oud bent;
– Als je in groep 3 t/m 8 van de basisschool zit;
– Als je op het speciaal onderwijs zit; je mag dan zelfs meedoen als je ouder bent dan 12. Geef dit dan aan bij opmerkingen op het wedstrijdformulier.
Hoe kun je meedoen?
Stuur voor 5 februari 2017 maximaal drie zelfbedachte gedichten in. Gedichten in braille, een groepsgedicht of een gedicht in een andere taal (stuur wel even een vertaling mee) zijn ook welkom. Alles wat je maar wilt, zolang het maar zelfverzonnen en -geschreven is!
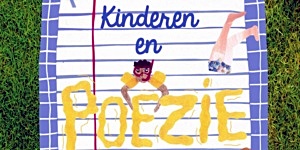 Wanneer mag je meedoen?
Wanneer mag je meedoen?
– Als je 6 t/m 12 jaar oud bent;
– Als je in groep 3 t/m 8 van de basisschool zit;
– Als je op het speciaal onderwijs zit; je mag dan zelfs meedoen als je ouder bent dan 12. Geef dit dan aan bij opmerkingen op het wedstrijdformulier.
Wat kun je winnen?
Als je meedoet aan de wedstrijd kun je leuke prijzen winnen, waaronder een plekje in een echte dichtbundel. Je maakt ook kans op één van de twee hoofdprijzen. Er is een hoofdprijs voor de middenbouw en een hoofdprijs voor de bovenbouw. Daarnaast is er ook nog een speciale prijs van de Kinderjury. Genoeg redenen om mee te doen dus!
Poëziepaleis zoekt talent!
Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Wil je tips voor het schrijven van gedichten? Neem dan een kijkje bij tips & Inspiratie.
# Meer informatie op website poëziepaleis
fleursdumal.nl magazine
More in: - Book Lovers, Art & Literature News, Children's Poetry, MODERN POETRY
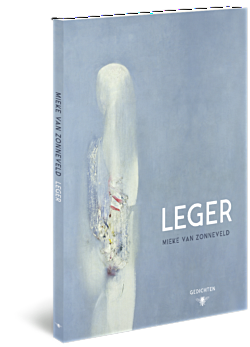 De salon van zaterdag 28 januari 2017 staat in het teken van Mieke van Zonneveld; zij presenteert haar debuutbundel ‘Leger’, uitgegeven door De Bezige Bij, en draagt eruit voor. Het programma brengt dichters die haar inspireren uit het heden en verleden, afgewisseld door passende muziek. Roland Holstprijswinnaar en voormalige stadsdichter van Amsterdam Menno Wigman draagt voor uit o.a. zijn laatste bundel ‘Slordig met geluk’. Simon Mulder draagt voor uit favoriete werken van J. H. Leopold.
De salon van zaterdag 28 januari 2017 staat in het teken van Mieke van Zonneveld; zij presenteert haar debuutbundel ‘Leger’, uitgegeven door De Bezige Bij, en draagt eruit voor. Het programma brengt dichters die haar inspireren uit het heden en verleden, afgewisseld door passende muziek. Roland Holstprijswinnaar en voormalige stadsdichter van Amsterdam Menno Wigman draagt voor uit o.a. zijn laatste bundel ‘Slordig met geluk’. Simon Mulder draagt voor uit favoriete werken van J. H. Leopold.
Presentatie debuut Mieke van Zonneveld met Menno Wigman
Op zaterdagavond 28 januari presenteert het Feest der Poëzie de dichter Mieke van Zonneveld met haar bundel ‘Leger’, uitgegeven door De Bezige Bij. Het programma vindt plaats in de prachtige omgeving van het Pianola Museum te Amsterdam. Naast een voordracht van Mieke van Zonneveld uit de nieuwe bundel, zal ook Menno Wigman, voormalig stadsdichter van Amsterdam en winnaar van de A. Roland Holstprijs, voordragen. Ook zijn er gedichten van J. H. Leopold en een pianorecital van Henk van Zonneveld.
Tevens vindt op 18 februari de akoestische reprise van Project Diepenbrock, onze voorstelling tijdens het Feest der Poëzie van 2014, plaats, met chansontrio En Vrac, Mieke van Zonneveld en Simon Mulder.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 28 januari 2017
Tijd: zaal open: 20 uur, aanvang: 20:30 uur
Locatie: Pianola Museum, Westerstraat 106, Amsterdam
Reserveren via info@pianola.nl wordt zeer aangeraden.
Meer informatie: www.feestderpoezie.nl onder ‘Salon der Verzen’
Mieke van Zonneveld (1989) – lid van collectief het Feest der Poëzie sinds het begin in 2008 – studeerde Nederlands en oudheidkunde aan de Vrije Universiteit en rondt momenteel haar onderzoeksmaster letterkunde af. Ze won in 2014 de landelijke Turing Gedichtenwedstrijd. Zij debuteert met een klassiek aandoende bundel over liefde en vriendschap, over ziekte en geloof. Leger is een gemystificeerd en genadeloos zelfonderzoek van een jonge dichter die de dood in de ogen heeft gekeken. Uitgeverij is Bezige Bij.
Mieke van Zonneveld debuteert met een klassiek aandoende bundel over liefde en vriendschap, over ziekte en geloof. Haar poëzie wekt de indruk van volledige helderheid, maar ze versluiert tegelijk. De eenvoud van woorden roept een grootsheid van beelden op waaronder telkens het risico sluimert uit het volle leven geknipt te worden. Slechts in dromen bestaat de mogelijkheid barrières te beslechten. Leger is een gemystificeerd en genadeloos zelfonderzoek van een jonge dichter die de dood in de ogen heeft gekeken.
Mieke van Zonneveld publiceerde enkele gedichten in voormalig literair tijdschrift De tweede ronde en in het ambachtelijk gedrukte Avantgaerde. Als lid van het Feest der Poëzie treedt ze af en toe op tijdens literaire salons. Ze is bezig met haar masteronderzoek Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
# Meer informatie op website feestderpoezie
fleursdumal.nl magazine
More in: - Book News, Archive Y-Z, Art & Literature News, City Poets / Stadsdichters, Feest der Poëzie, Leopold, J.H., Literary Events, MODERN POETRY, MUSIC, Wigman, Menno
 A Physiologist’s Wife
A Physiologist’s Wife
by Arthur Conan Doyle
Professor Ainslie Grey had not come down to breakfast at the usual hour. The presentation chiming-clock which stood between the terra-cotta busts of Claude Bernard and of John Hunter upon the dining-room mantelpiece had rung out the half-hour and the three-quarters. Now its golden hand was verging upon the nine, and yet there were no signs of the master of the house.
It was an unprecedented occurrence. During the twelve years that she had kept house for him, his youngest sister had never known him a second behind his time. She sat now in front of the high silver coffee-pot, uncertain whether to order the gong to be resounded or to wait on in silence. Either course might be a mistake. Her brother was not a man who permitted mistakes.
Miss Ainslie Grey was rather above the middle height, thin, with peering, puckered eyes, and the rounded shoulders which mark the bookish woman. Her face was long and spare, flecked with colour above the cheek-bones, with a reasonable, thoughtful forehead, and a dash of absolute obstinacy in her thin lips and prominent chin. Snow white cuffs and collar, with a plain dark dress, cut with almost Quaker-like simplicity, bespoke the primness of her taste. An ebony cross hung over her flattened chest. She sat very upright in her chair, listening with raised eyebrows, and swinging her eye-glasses backwards and forwards with a nervous gesture which was peculiar to her.
Suddenly she gave a sharp, satisfied jerk of the head, and began to pour out the coffee. From outside there came the dull thudding sound of heavy feet upon thick carpet. The door swung open, and the Professor entered with a quick, nervous step. He nodded to his sister, and seating himself at the other side of the table, began to open the small pile of letters which lay beside his plate.
Professor Ainslie Grey was at that time forty-three years of age—nearly twelve years older than his sister. His career had been a brilliant one. At Edinburgh, at Cambridge, and at Vienna he had laid the foundations of his great reputation, both in physiology and in zoology.
His pamphlet, On the Mesoblastic Origin of Excitomotor Nerve Roots, had won him his fellowship of the Royal Society; and his researches, Upon the Nature of Bathybius, with some Remarks upon Lithococci, had been translated into at least three European languages. He had been referred to by one of the greatest living authorities as being the very type and embodiment of all that was best in modern science. No wonder, then, that when the commercial city of Birchespool decided to create a medical school, they were only too glad to confer the chair of physiology upon Mr. Ainslie Grey. They valued him the more from the conviction that their class was only one step in his upward journey, and that the first vacancy would remove him to some more illustrious seat of learning.
In person he was not unlike his sister. The same eyes, the same contour, the same intellectual forehead. His lips, however, were firmer, and his long, thin, lower jaw was sharper and more decided. He ran his finger and thumb down it from time to time, as he glanced over his letters.
“Those maids are very noisy,” he remarked, as a clack of tongues sounded in the distance.
“It is Sarah,” said his sister; “I shall speak about it.”
She had handed over his coffee-cup, and was sipping at her own, glancing furtively through her narrowed lids at the austere face of her brother.
“The first great advance of the human race,” said the Professor, “was when, by the development of their left frontal convolutions, they attained the power of speech. Their second advance was when they learned to control that power. Woman has not yet attained the second stage.”
He half closed his eyes as he spoke, and thrust his chin forward, but as he ceased he had a trick of suddenly opening both eyes very wide and staring sternly at his interlocutor.
“I am not garrulous, John,” said his sister.
“No, Ada; in many respects you approach the superior or male type.”
The Professor bowed over his egg with the manner of one who utters a courtly compliment; but the lady pouted, and gave an impatient little shrug of her shoulders.
“You were late this morning, John,” she remarked, after a pause.
“Yes, Ada; I slept badly. Some little cerebral congestion, no doubt due to over-stimulation of the centers of thought. I have been a little disturbed in my mind.”
His sister stared across at him in astonishment. The Professor’s mental processes had hitherto been as regular as his habits. Twelve years’ continual intercourse had taught her that he lived in a serene and rarefied atmosphere of scientific calm, high above the petty emotions which affect humbler minds.
“You are surprised, Ada,” he remarked. “Well, I cannot wonder at it. I should have been surprised myself if I had been told that I was so sensitive to vascular influences. For, after all, all disturbances are vascular if you probe them deep enough. I am thinking of getting married.”
“Not Mrs. O’James” cried Ada Grey, laying down her egg-spoon.
“My dear, you have the feminine quality of receptivity very remarkably developed. Mrs. O’James is the lady in question.”
“But you know so little of her. The Esdailes themselves know so little. She is really only an acquaintance, although she is staying at The Lindens. Would it not be wise to speak to Mrs. Esdaile first, John?”
“I do not think, Ada, that Mrs. Esdaile is at all likely to say anything which would materially affect my course of action. I have given the matter due consideration. The scientific mind is slow at arriving at conclusions, but having once formed them, it is not prone to change. Matrimony is the natural condition of the human race. I have, as you know, been so engaged in academical and other work, that I have had no time to devote to merely personal questions. It is different now, and I see no valid reason why I should forego this opportunity of seeking a suitable helpmate.”
“And you are engaged?”
“Hardly that, Ada. I ventured yesterday to indicate to the lady that I was prepared to submit to the common lot of humanity. I shall wait upon her after my morning lecture, and learn how far my proposals meet with her acquiescence. But you frown, Ada!”
His sister started, and made an effort to conceal her expression of annoyance. She even stammered out some few words of congratulation, but a vacant look had come into her brother’s eyes, and he was evidently not listening to her.
“I am sure, John, that I wish you the happiness which you deserve. If I hesitated at all, it is because I know how much is at stake, and because the thing is so sudden, so unexpected.” Her thin white hand stole up to the black cross upon her bosom. “These are moments when we need guidance, John. If I could persuade you to turn to spiritual——”
The Professor waved the suggestion away with a deprecating hand.
“It is useless to reopen that question,” he said. “We cannot argue upon it. You assume more than I can grant. I am forced to dispute your premises. We have no common basis.”
His sister sighed.
“You have no faith,” she said.
“I have faith in those great evolutionary forces which are leading the human race to some unknown but elevated goal.”
“You believe in nothing.”
“On the contrary, my dear Ada, I believe in the differentiation of protoplasm.”
She shook her head sadly. It was the one subject upon which she ventured to dispute her brother’s infallibility.
“This is rather beside the question,” remarked the Professor, folding up his napkin. “If I am not mistaken, there is some possibility of another matrimonial event occurring in the family. Eh, Ada? What!”
His small eyes glittered with sly facetiousness as he shot a twinkle at his sister. She sat very stiff, and traced patterns upon the cloth with the sugar-tongs.
“Dr. James M’Murdo O’Brien——” said the Professor, sonorously.
“Don’t, John, don’t!” cried Miss Ainslie Grey.
“Dr. James M’Murdo O’Brien,” continued her brother inexorably, “is a man who has already made his mark upon the science of the day. He is my first and my most distinguished pupil. I assure you, Ada, that his ‘Remarks upon the Bile-Pigments, with special reference to Urobilin,’ is likely to live as a classic. It is not too much to say that he has revolutionised our views about urobilin.”
He paused, but his sister sat silent, with bent head and flushed cheeks. The little ebony cross rose and fell with her hurried breathings.
“Dr. James M’Murdo O’Brien has, as you know, the offer of the physiological chair at Melbourne. He has been in Australia five years, and has a brilliant future before him. To-day he leaves us for Edinburgh, and in two months’ time, he goes out to take over his new duties. You know his feeling towards you. It, rests with you as to whether he goes out alone. Speaking for myself, I cannot imagine any higher mission for a woman of culture than to go through life in the company of a man who is capable of such a research as that which Dr. James M’Murdo O’Brien has brought to a successful conclusion.”
“He has not spoken to me,” murmured the lady.
“Ah, there are signs which are more subtle than speech,” said her brother, wagging his head. “But you are pale. Your vasomotor system is excited. Your arterioles have contracted. Let me entreat you to compose yourself. I think I hear the carriage. I fancy that you may have a visitor this morning, Ada. You will excuse me now.”
With a quick glance at the clock he strode off into the hall, and within a few minutes he was rattling in his quiet, well-appointed brougham through the brick-lined streets of Birchespool.
His lecture over, Professor Ainslie Grey paid a visit to his laboratory, where he adjusted several scientific instruments, made a note as to the progress of three separate infusions of bacteria, cut half-a-dozen sections with a microtome, and finally resolved the difficulties of seven different gentlemen, who were pursuing researches in as many separate lines of inquiry. Having thus conscientiously and methodically completed the routine of his duties, he returned to his carriage and ordered the coachman to drive him to The Lindens. His face as he drove was cold and impassive, but he drew his fingers from time to time down his prominent chin with a jerky, twitchy movement.
The Lindens was an old-fashioned, ivy-clad house which had once been in the country, but was now caught in the long, red-brick feelers of the growing city. It still stood back from the road in the privacy of its own grounds. A winding path, lined with laurel bushes, led to the arched and porticoed entrance. To the right was a lawn, and at the far side, under the shadow of a hawthorn, a lady sat in a garden-chair with a book in her hands. At the click of the gate she started, and the Professor, catching sight of her, turned away from the door, and strode in her direction.
“What! won’t you go in and see Mrs. Esdaile?” she asked, sweeping out from under the shadow of the hawthorn.
She was a small woman, strongly feminine, from the rich coils of her light-coloured hair to the dainty garden slipper which peeped from under her cream-tinted dress. One tiny well-gloved hand was outstretched in greeting, while the other pressed a thick, green-covered volume against her side. Her decision and quick, tactful manner bespoke the mature woman of the world; but her upraised face had preserved a girlish and even infantile expression of innocence in its large, fearless, grey eyes, and sensitive, humorous mouth. Mrs. O’James was a widow, and she was two-and-thirty years of age; but neither fact could have been deduced from her appearance.
“You will surely go in and see Mrs. Esdaile,” she repeated, glancing up at him with eyes which had in them something between a challenge and a caress.
“I did not come to see Mrs. Esdaile,” he answered, with no relaxation of his cold and grave manner; “I came to see you.”
“I am sure I should be highly honoured,” she said, with just the slightest little touch of brogue in her accent. “What are the students to do without their Professor?”
“I have already completed my academic duties. Take my arm, and we shall walk in the sunshine. Surely we cannot wonder that Eastern people should have made a deity of the sun. It is the great beneficent force of Nature—man’s ally against cold, sterility, and all that is abhorrent to him. What were you reading?”
“Hale’s Matter and Life.”
The Professor raised his thick eyebrows.
“Hale!” he said, and then again in a kind of whisper, “Hale!”
“You differ from him?” she asked.
“It is not I who differ from him. I am only a monad—a thing of no moment. The whole tendency of the highest plane of modern thought differs from him. He defends the indefensible. He is an excellent observer, but a feeble reasoner. I should not recommend you to found your conclusions upon Hale.”
“I must read Nature’s Chronicle to counteract his pernicious influence,” said Mrs. O’James, with a soft, cooing laugh.
Nature’s Chronicle was one of the many books in which Professor Ainslie Grey had enforced the negative doctrines of scientific agnosticism.
“It is a faulty work,” said he; “I cannot recommend it. I would rather refer you to the standard writings of some of my older and more eloquent colleagues.”
There was a pause in their talk as they paced up and down on the green, velvet-like lawn in the genial sunshine.
“Have you thought at all,” he asked at last, “of the matter upon which I spoke to you last night?”
She said nothing, but walked by his side with her eyes averted and her face aslant.
“I would not hurry you unduly,” he continued. “I know that it is a matter which can scarcely be decided off-hand. In my own case, it cost me some thought before I ventured to make the suggestion. I am not an emotional man, but I am conscious in your presence of the great evolutionary instinct which makes either sex the complement of the other.”
“You believe in love, then?” she asked, with a twinkling, upward glance.
“I am forced to.”
“And yet you can deny the soul?”
“How far these questions are psychic and how far material is still sub judice,” said the Professor, with an air of toleration. “Protoplasm may prove to be the physical basis of love as well as of life.”
“How inflexible you are!” she exclaimed; “you would draw love down to the level of physics.”
“Or draw physics up to the level of love.”
“Come, that is much better,” she cried, with her sympathetic laugh. “That is really very pretty, and puts science in quite a delightful light.”
Her eyes sparkled, and she tossed her chin with the pretty, wilful air of a woman who is mistress of the situation.
“I have reason to believe,” said the Professor, “that my position here will prove to be only a stepping-stone to some wider scene of scientific activity. Yet, even here, my chair brings me in some fifteen hundred pounds a year, which is supplemented by a few hundreds from my books. I should therefore be in a position to provide you with those comforts to which you are accustomed. So much for my pecuniary position. As to my constitution, it has always been sound. I have never suffered from any illness in my life, save fleeting attacks of cephalalgia, the result of too prolonged a stimulation of the centres of cerebration. My father and mother had no sign of any morbid diathesis, but I will not conceal from you that my grandfather was afflicted with podagra.”
Mrs. O’James looked startled.
“Is that very serious?” she asked.
“It is gout,” said the Professor.
“Oh, is that all? It sounded much worse than that.”
“It is a grave taint, but I trust that I shall not be a victim to atavism. I have laid these facts before you because they are factors which cannot be overlooked in forming your decision. May I ask now whether you see your way to accepting my proposal?”
He paused in his walk, and looked earnestly and expectantly down at her.
A struggle was evidently going on in her mind. Her eyes were cast down, her little slipper tapped the lawn, and her fingers played nervously with her chatelain. Suddenly, with a sharp, quick gesture which had in it something of ABANDON and recklessness, she held out her hand to her companion.
“I accept,” she said.
They were standing under the shadow of the hawthorn. He stooped gravely down, and kissed her glove-covered fingers.
“I trust that you may never have cause to regret your decision,” he said.
“I trust that you never may,” she cried, with a heaving breast.
There were tears in her eyes, and her lips twitched with some strong emotion.
“Come into the sunshine again,” said he. “It is the great restorative. Your nerves are shaken. Some little congestion of the medulla and pons. It is always instructive to reduce psychic or emotional conditions to their physical equivalents. You feel that your anchor is still firm in a bottom of ascertained fact.”
“But it is so dreadfully unromantic,” said Mrs. O’James, with her old twinkle.
“Romance is the offspring of imagination and of ignorance. Where science throws her calm, clear light there is happily no room for romance.”
“But is not love romance?” she asked.
“Not at all. Love has been taken away from the poets, and has been brought within the domain of true science. It may prove to be one of the great cosmic elementary forces. When the atom of hydrogen draws the atom of chlorine towards it to form the perfected molecule of hydrochloric acid, the force which it exerts may be intrinsically similar to that which draws me to you. Attraction and repulsion appear to be the primary forces. This is attraction.”
“And here is repulsion,” said Mrs. O’James, as a stout, florid lady came sweeping across the lawn in their direction. “So glad you have come out, Mrs. Esdaile! Here is Professor Grey.”
“How do you do, Professor?” said the lady, with some little pomposity of manner. “You were very wise to stay out here on so lovely a day. Is it not heavenly?”
“It is certainly very fine weather,” the Professor answered.
“Listen to the wind sighing in the trees!” cried Mrs. Esdaile, holding up one finger. “It is Nature’s lullaby. Could you not imagine it, Professor Grey, to be the whisperings of angels?”
“The idea had not occurred to me, madam.”
“Ah, Professor, I have always the same complaint against you. A want of rapport with the deeper meanings of nature. Shall I say a want of imagination. You do not feel an emotional thrill at the singing of that thrush?”
“I confess that I am not conscious of one, Mrs. Esdaile.”
“Or at the delicate tint of that background of leaves? See the rich greens!”
“Chlorophyll,” murmured the Professor.
“Science is so hopelessly prosaic. It dissects and labels, and loses sight of the great things in its attention to the little ones. You have a poor opinion of woman’s intellect, Professor Grey. I think that I have heard you say so.”
“It is a question of avoirdupois,” said the Professor, closing his eyes and shrugging his shoulders. “The female cerebrum averages two ounces less in weight than the male. No doubt there are exceptions. Nature is always elastic.”
“But the heaviest thing is not always the strongest,” said Mrs. O’James, laughing. “Isn’t there a law of compensation in science? May we not hope to make up in quality for what we lack in quantity?”
“I think not,” remarked the Professor, gravely. “But there is your luncheon-gong. No, thank you, Mrs. Esdaile, I cannot stay. My carriage is waiting. Good-bye. Good-bye, Mrs. O’James.”
He raised his hat and stalked slowly away among the laurel bushes.
“He has no taste,” said Mrs. Esdaile—“no eye for beauty.”
“On the contrary,” Mrs. O’James answered, with a saucy little jerk of the chin. “He has just asked me to be his wife.”
As Professor Ainslie Grey ascended the steps of his house, the hall-door opened and a dapper gentleman stepped briskly out. He was somewhat sallow in the face, with dark, beady eyes, and a short, black beard with an aggressive bristle. Thought and work had left their traces upon his face, but he moved with the brisk activity of a man who had not yet bade good-bye to his youth.
“I’m in luck’s way,” he cried. “I wanted to see you.”
“Then come back into the library,” said the Professor; “you must stay and have lunch with us.”
The two men entered the hall, and the Professor led the way into his private sanctum. He motioned his companion into an arm-chair.
“I trust that you have been successful, O’Brien,” said he. “I should be loath to exercise any undue pressure upon my sister Ada; but I have given her to understand that there is no one whom I should prefer for a brother-in-law to my most brilliant scholar, the author of Some Remarks upon the Bile-Pigments, with special reference to Urobilin.”
“You are very kind, Professor Grey—you have always been very kind,” said the other. “I approached Miss Grey upon the subject; she did not say No.”
“She said Yes, then?”
“No; she proposed to leave the matter open until my return from Edinburgh. I go to-day, as you know, and I hope to commence my research to-morrow.”
“On the comparative anatomy of the vermiform appendix, by James M’Murdo O’Brien,” said the Professor, sonorously. “It is a glorious subject—a subject which lies at the very root of evolutionary philosophy.”
“Ah! she is the dearest girl,” cried O’Brien, with a sudden little spurt of Celtic enthusiasm—“she is the soul of truth and of honour.”
“The vermiform appendix——” began the Professor.
“She is an angel from heaven,” interrupted the other. “I fear that it is my advocacy of scientific freedom in religious thought which stands in my way with her.”
“You must not truckle upon that point. You must be true to your convictions; let there be no compromise there.”
“My reason is true to agnosticism, and yet I am conscious of a void—a vacuum. I had feelings at the old church at home between the scent of the incense and the roll of the organ, such as I have never experienced in the laboratory or the lecture-room.”
“Sensuous-purely sensuous,” said the Professor, rubbing his chin. “Vague hereditary tendencies stirred into life by the stimulation of the nasal and auditory nerves.”
“Maybe so, maybe so,” the younger man answered thoughtfully. “But this was not what I wished to speak to you about. Before I enter your family, your sister and you have a claim to know all that I can tell you about my career. Of my worldly prospects I have already spoken to you. There is only one point which I have omitted to mention. I am a widower.”
The Professor raised his eyebrows.
“This is news indeed,” said he.
“I married shortly after my arrival in Australia. Miss Thurston was her name. I met her in society. It was a most unhappy match.”
Some painful emotion possessed him. His quick, expressive features quivered, and his white hands tightened upon the arms of the chair. The Professor turned away towards the window.
“You are the best judge,” he remarked “but I should not think that it was necessary to go into details.”
“You have a right to know everything—you and Miss Grey. It is not a matter on which I can well speak to her direct. Poor Jinny was the best of women, but she was open to flattery, and liable to be misled by designing persons. She was untrue to me, Grey. It is a hard thing to say of the dead, but she was untrue to me. She fled to Auckland with a man whom she had known before her marriage. The brig which carried them foundered, and not a soul was saved.”
“This is very painful, O’Brien,” said the Professor, with a deprecatory motion of his hand. “I cannot see, however, how it affects your relation to my sister.”
“I have eased my conscience,” said O’Brien, rising from his chair; “I have told you all that there is to tell. I should not like the story to reach you through any lips but my own.”
“You are right, O’Brien. Your action has been most honourable and considerate. But you are not to blame in the matter, save that perhaps you showed a little precipitancy in choosing a life-partner without due care and inquiry.”
O’Brien drew his hand across his eyes.
“Poor girl!” he cried. “God help me, I love her still! But I must go.”
“You will lunch with us?”
“No, Professor; I have my packing still to do. I have already bade Miss Grey adieu. In two months I shall see you again.”
“You will probably find me a married man.”
“Married!”
“Yes, I have been thinking of it.”
“My dear Professor, let me congratulate you with all my heart. I had no idea. Who is the lady?”
“Mrs. O’James is her name—a widow of the same nationality as yourself. But to return to matters of importance, I should be very happy to see the proofs of your paper upon the vermiform appendix. I may be able to furnish you with material for a footnote or two.”
“Your assistance will be invaluable to me,” said O’Brien, with enthusiasm, and the two men parted in the hall. The Professor walked back into the dining-room, where his sister was already seated at the luncheon-table.
“I shall be married at the registrar’s,” he remarked; “I should strongly recommend you to do the same.”
Professor Ainslie Grey was as good as his word. A fortnight’s cessation of his classes gave him an opportunity which was too good to let pass. Mrs. O’James was an orphan, without relations and almost without friends in the country. There was no obstacle in the way of a speedy wedding. They were married, accordingly, in the quietest manner possible, and went off to Cambridge together, where the Professor and his charming wife were present at several academic observances, and varied the routine of their honeymoon by incursions into biological laboratories and medical libraries. Scientific friends were loud in their congratulations, not only upon Mrs. Grey’s beauty, but upon the unusual quickness and intelligence which she displayed in discussing physiological questions. The Professor was himself astonished at the accuracy of her information. “You have a remarkable range of knowledge for a woman, Jeannette,” he remarked upon more than one occasion. He was even prepared to admit that her cerebrum might be of the normal weight.
One foggy, drizzling morning they returned to Birchespool, for the next day would re-open the session, and Professor Ainslie Grey prided himself upon having never once in his life failed to appear in his lecture-room at the very stroke of the hour. Miss Ada Grey welcomed them with a constrained cordiality, and handed over the keys of office to the new mistress. Mrs. Grey pressed her warmly to remain, but she explained that she had already accepted an invitation which would engage her for some months. The same evening she departed for the south of England.
A couple of days later the maid carried a card just after breakfast into the library where the Professor sat revising his morning lecture. It announced the re-arrival of Dr. James M’Murdo O’Brien. Their meeting was effusively genial on the part of the younger man, and coldly precise on that of his former teacher.
“You see there have been changes,” said the Professor.
“So I heard. Miss Grey told me in her letters, and I read the notice in the British Medical Journal. So it’s really married you are. How quickly and quietly you have managed it all!”
“I am constitutionally averse to anything in the nature of show or ceremony. My wife is a sensible woman—I may even go the length of saying that, for a woman, she is abnormally sensible. She quite agreed with me in the course which I have adopted.”
“And your research on Vallisneria?”
“This matrimonial incident has interrupted it, but I have resumed my classes, and we shall soon be quite in harness again.”
“I must see Miss Grey before I leave England. We have corresponded, and I think that all will be well. She must come out with me. I don’t think I could go without her.”
The Professor shook his head.
“Your nature is not so weak as you pretend,” he said. “Questions of this sort are, after all, quite subordinate to the great duties of life.”
O’Brien smiled.
“You would have me take out my Celtic soul and put in a Saxon one,” he said. “Either my brain is too small or my heart is too big. But when may I call and pay my respects to Mrs. Grey? Will she be at home this afternoon?”
“She is at home now. Come into the morning-room. She will be glad to make your acquaintance.”
They walked across the linoleum-paved hall. The Professor opened the door of the room, and walked in, followed by his friend. Mrs. Grey was sitting in a basket-chair by the window, light and fairy-like in a loose-flowing, pink morning-gown. Seeing a visitor, she rose and swept towards them. The Professor heard a dull thud behind him. O’Brien had fallen back into a chair, with his hand pressed tight to his side.
“Jinny!” he gasped—“Jinny!”
Mrs. Grey stopped dead in her advance, and stared at him with a face from which every expression had been struck out, save one of astonishment and horror. Then with a sharp intaking of the breath she reeled, and would have fallen had the Professor not thrown his long, nervous arm round her.
“Try this sofa,” said he.
She sank back among the cushions with the same white, cold, dead look upon her face. The Professor stood with his back to the empty fireplace and glanced from the one to the other.
“So, O’Brien,” he said at last, “you have already made the acquaintance of my wife!”
“Your wife,” cried his friend hoarsely. “She is no wife of yours. God help me, she is MY wife.”
The Professor stood rigidly upon the hearthrug. His long, thin fingers were intertwined, and his head sunk a little forward. His two companions had eyes only for each other.
“Jinny!” said he.
“James!”
“How could you leave me so, Jinny? How could you have the heart to do it? I thought you were dead. I mourned for your death—ay, and you have made me mourn for you living. You have withered my life.”
She made no answer, but lay back among her cushions with her eyes still fixed upon him.
“Why do you not speak?”
“Because you are right, James. I HAVE treated you cruelly—shamefully. But it is not as bad as you think.”
“You fled with De Horta.”
“No, I did not. At the last moment my better nature prevailed. He went alone. But I was ashamed to come back after what I had written to you. I could not face you. I took passage alone to England under a new name, and here I have lived ever since. It seemed to me that I was beginning life again. I knew that you thought I was drowned. Who could have dreamed that fate would throw us together again! When the Professor asked me——”
She stopped and gave a gasp for breath.
“You are faint,” said the Professor—“keep the head low; it aids the cerebral circulation.” He flattened down the cushion. “I am sorry to leave you, O’Brien; but I have my class duties to look to. Possibly I may find you here when I return.”
With a grim and rigid face he strode out of the room. Not one of the three hundred students who listened to his lecture saw any change in his manner and appearance, or could have guessed that the austere gentleman in front of them had found out at last how hard it is to rise above one’s humanity. The lecture over, he performed his routine duties in the laboratory, and then drove back to his own house. He did not enter by the front door, but passed through the garden to the folding glass casement which led out of the morning-room. As he approached he heard his wife’s voice and O’Brien’s in loud and animated talk. He paused among the rose-bushes, uncertain whether to interrupt them or no. Nothing was further from his nature than play the eavesdropper; but as he stood, still hesitating, words fell upon his ear which struck him rigid and motionless.
“You are still my wife, Jinny,” said O’Brien; “I forgive you from the bottom of my heart. I love you, and I have never ceased to love you, though you had forgotten me.”
“No, James, my heart was always in Melbourne. I have always been yours. I thought that it was better for you that I should seem to be dead.”
“You must choose between us now, Jinny. If you determine to remain here, I shall not open my lips. There shall be no scandal. If, on the other hand, you come with me, it’s little I care about the world’s opinion. Perhaps I am as much to blame as you. I thought too much of my work and too little of my wife.”
The Professor heard the cooing, caressing laugh which he knew so well.
“I shall go with you, James,” she said.
“And the Professor——?”
“The poor Professor! But he will not mind much, James; he has no heart.”
“We must tell him our resolution.”
“There is no need,” said Professor Ainslie Grey, stepping in through the open casement. “I have overheard the latter part of your conversation. I hesitated to interrupt you before you came to a conclusion.”
O’Brien stretched out his hand and took that of the woman. They stood together with the sunshine on their faces. The Professor paused at the casement with his hands behind his back, and his long black shadow fell between them.
“You have come to a wise decision,” said he. “Go back to Australia together, and let what has passed be blotted out of your lives.”
“But you—you——” stammered O’Brien.
The Professor waved his hand.
“Never trouble about me,” he said.
The woman gave a gasping cry.
“What can I do or say?” she wailed. “How could I have foreseen this? I thought my old life was dead. But it has come back again, with all its hopes and its desires. What can I say to you, Ainslie? I have brought shame and disgrace upon a worthy man. I have blasted your life. How you must hate and loathe me! I wish to God that I had never been born!”
“I neither hate nor loathe you, Jeannette,” said the Professor, quietly. “You are wrong in regretting your birth, for you have a worthy mission before you in aiding the life-work of a man who has shown himself capable of the highest order of scientific research. I cannot with justice blame you personally for what has occurred. How far the individual monad is to be held responsible for hereditary and engrained tendencies, is a question upon which science has not yet said her last word.”
He stood with his finger-tips touching, and his body inclined as one who is gravely expounding a difficult and impersonal subject. O’Brien had stepped forward to say something, but the other’s attitude and manner froze the words upon his lips. Condolence or sympathy would be an impertinence to one who could so easily merge his private griefs in broad questions of abstract philosophy.
“It is needless to prolong the situation,” the Professor continued, in the same measured tones. “My brougham stands at the door. I beg that you will use it as your own. Perhaps it would be as well that you should leave the town without unnecessary delay. Your things, Jeannette, shall be forwarded.”
O’Brien hesitated with a hanging head.
“I hardly dare offer you my hand,” he said.
“On the contrary. I think that of the three of us you come best out of the affair. You have nothing to be ashamed of.”
“Your sister——”
“I shall see that the matter is put to her in its true light. Good-bye! Let me have a copy of your recent research. Good-bye, Jeannette!”
“Good-bye!”
Their hands met, and for one short moment their eyes also. It was only a glance, but for the first and last time the woman’s intuition cast a light for itself into the dark places of a strong man’s soul. She gave a little gasp, and her other hand rested for an instant, as white and as light as thistle-down, upon his shoulder.
“James, James!” she cried. “Don’t you see that he is stricken to the heart?”
He turned her quietly away from him.
“I am not an emotional man,” he said. “I have my duties—my research on Vallisneria. The brougham is there. Your cloak is in the hall. Tell John where you wish to be driven. He will bring you anything you need. Now go.”
His last two words were so sudden, so volcanic, in such contrast to his measured voice and mask-like face, that they swept the two away from him. He closed the door behind them and paced slowly up and down the room. Then he passed into the library and looked out over the wire blind. The carriage was rolling away. He caught a last glimpse of the woman who had been his wife. He saw the feminine droop of her head, and the curve of her beautiful throat.
Under some foolish, aimless impulse, he took a few quick steps towards the door. Then he turned, and throwing himself into his study-chair he plunged back into his work.
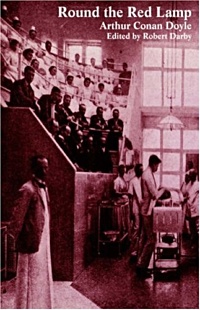 There was little scandal about this singular domestic incident. The Professor had few personal friends, and seldom went into society. His marriage had been so quiet that most of his colleagues had never ceased to regard him as a bachelor. Mrs. Esdaile and a few others might talk, but their field for gossip was limited, for they could only guess vaguely at the cause of this sudden separation.
There was little scandal about this singular domestic incident. The Professor had few personal friends, and seldom went into society. His marriage had been so quiet that most of his colleagues had never ceased to regard him as a bachelor. Mrs. Esdaile and a few others might talk, but their field for gossip was limited, for they could only guess vaguely at the cause of this sudden separation.
The Professor was as punctual as ever at his classes, and as zealous in directing the laboratory work of those who studied under him. His own private researches were pushed on with feverish energy. It was no uncommon thing for his servants, when they came down of a morning, to hear the shrill scratchings of his tireless pen, or to meet him on the staircase as he ascended, grey and silent, to his room. In vain his friends assured him that such a life must undermine his health. He lengthened his hours until day and night were one long, ceaseless task.
Gradually under this discipline a change came over his appearance. His features, always inclined to gauntness, became even sharper and more pronounced. There were deep lines about his temples and across his brow. His cheek was sunken and his complexion bloodless. His knees gave under him when he walked; and once when passing out of his lecture-room he fell and had to be assisted to his carriage.
This was just before the end of the session and soon after the holidays commenced the professors who still remained in Birchespool were shocked to hear that their brother of the chair of physiology had sunk so low that no hopes could be entertained of his recovery. Two eminent physicians had consulted over his case without being able to give a name to the affection from which he suffered. A steadily decreasing vitality appeared to be the only symptom—a bodily weakness which left the mind unclouded. He was much interested himself in his own case, and made notes of his subjective sensations as an aid to diagnosis. Of his approaching end he spoke in his usual unemotional and somewhat pedantic fashion. “It is the assertion,” he said, “of the liberty of the individual cell as opposed to the cell-commune. It is the dissolution of a co-operative society. The process is one of great interest.”
And so one grey morning his co-operative society dissolved. Very quietly and softly he sank into his eternal sleep. His two physicians felt some slight embarrassment when called upon to fill in his certificate.
“It is difficult to give it a name,” said one.
“Very,” said the other.
“If he were not such an unemotional man, I should have said that he had died from some sudden nervous shock—from, in fact, what the vulgar would call a broken heart.”
“I don’t think poor Grey was that sort of a man at all.”
“Let us call it cardiac, anyhow,” said the older physician.
So they did so.
Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930)
Round the Red Lamp: Being Facts and Fancies of Medical Life
Physiologist’s Wife (#08)
fleursdumal.nl magazine
More in: Doyle, Arthur Conan, Doyle, Arthur Conan, DRUGS & DISEASE & MEDICINE & LITERATURE, Round the Red Lamp
Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature