Fleurs du Mal Magazine


Or see the index

More in: - Book Lovers, - Book News, - Book Stories, - Bookstores, The Art of Reading

More in: - Book Lovers, - Book News, - Book Stories, - Bookstores, Art & Literature News, PRESS & PUBLISHING, The Art of Reading
Gevatter Tod
Es lebte einmal ein sehr armer Mann, hieß Klaus, dem hatte Gott eine Fülle Reichtum beschert, der ihm große Sorge machte, nämlich zwölf Kinder, und über ein kleines so kam noch ein Kleines, das war das dreizehnte Kind. Da wußte der arme Mann seiner Sorge keinen Rat, wo er doch einen Paten hernehmen sollte, denn seine ganze Sipp- und Magschaft hatte ihm schon Kinder aus der Taufe gehoben, und er durfte nicht hoffen, noch unter seinen Freunden eine mitleidige Seele zu finden, die ihm sein jüngstgebornes Kindlein hebe. Gedachte also an den ersten besten wildfremden Menschen sich zu wenden, zumal manche seiner Bekannten ihn in ähnlichen Fällen schon mit vieler Hartherzigkeit abschläglich beschieden hatten.
Der arme Kindesvater ging also auf die Landstraße hinaus, willens, dem ersten ihm Begegnenden die Patenstelle seines Kindleins anzutragen. Und siehe, ihm begegnete bald ein gar freundlicher Mann, stattlichen Aussehens, wohlgestaltet, nicht alt nicht jung, mild und gütig von Angesicht, und da kam es dem Armen vor, als neigten sich vor jenem Manne die Bäume und Blümlein und alle Gras- und Getreidehalme. Da dünkte dem Klaus, das müsse der liebe Gott sein, nahm seine schlechte Mütze ab, faltete die Hände und betete ein Vater Unser. Und es war auch der liebe Gott, der wußte, was Klaus wollte, ehe er noch bat, und sprach: »Du suchst einen Paten für dein Kindlein! Wohlan, ich will es dir heben, ich, der liebe Gott!«
 »Du bist allzugütig, lieber Gott!« antwortete Klaus verzagt. »Aber ich danke dir; du gibst denen, welche haben, einem Güter, dem andern Kinder, so fehlt es oft beiden am Besten, und der Reiche schwelgt, der Arme hungert!« Auf diese Rede wandte sich der Herr und ward nicht mehr gesehen. Klaus ging weiter, und wie er eine Strecke gegangen war, kam ein Kerl auf ihn zu, der sah nicht nur aus, wie der Teufel, sondern war’s auch, und fragte Klaus, wen er suche? – Er suche einen Paten für sein Kindlein. – »Ei da nimm mich, ich mach es reich!« – »Wer bist du!« fragte Klaus. »Ich bin der Teufel« – »Das wär der Teufel!« rief Klaus, und maß den Mann vom Horn bis zum Pferdefuß. Dann sagte er: »Mit Verlaub, geh heim zu dir und zu deiner Großmutter; dich mag ich nicht zum Gevatter, du bist der Allerböseste! Gott sei bei uns!«
»Du bist allzugütig, lieber Gott!« antwortete Klaus verzagt. »Aber ich danke dir; du gibst denen, welche haben, einem Güter, dem andern Kinder, so fehlt es oft beiden am Besten, und der Reiche schwelgt, der Arme hungert!« Auf diese Rede wandte sich der Herr und ward nicht mehr gesehen. Klaus ging weiter, und wie er eine Strecke gegangen war, kam ein Kerl auf ihn zu, der sah nicht nur aus, wie der Teufel, sondern war’s auch, und fragte Klaus, wen er suche? – Er suche einen Paten für sein Kindlein. – »Ei da nimm mich, ich mach es reich!« – »Wer bist du!« fragte Klaus. »Ich bin der Teufel« – »Das wär der Teufel!« rief Klaus, und maß den Mann vom Horn bis zum Pferdefuß. Dann sagte er: »Mit Verlaub, geh heim zu dir und zu deiner Großmutter; dich mag ich nicht zum Gevatter, du bist der Allerböseste! Gott sei bei uns!«
Da drehte sich der Teufel herum, zeigte dem Klaus eine abscheuliche Fratze, füllte die Luft mit Schwefelgestank und fuhr von dannen. Hierauf begegnete dem Kindesvater abermals ein Mann, der war spindeldürr, wie eine Hopfenstange, so dürr, daß er klapperte; der fragte auch: »Wen suchst du?« und bot sich zum Paten des Kindes an. »Wer bist du?« fragte Klaus. »Ich bin der Tod!« sprach jener mit ganz heiserer Summe. – Da war der Klaus zum Tod erschrocken, doch faßte er sich Mut, dachte: bei dem wär mein dreizehntes Söhnlein am besten aufgehoben, und sprach: »du bist der Rechte! Arm oder reich, du machst es gleich. Topp! Du sollst mein Gevattersmann sein! Stell dich nur ein zu rechter Zeit, am Sonntag soll die Taufe sein.«
Und am Sonntag kam richtig der Tod, und ward ein ordentlicher Dot, das ist Taufpat des Kleinen, und der Junge wuchs und gedieh ganz fröhlich. Als er nun zu den Jahren gekommen war, wo der Mensch etwas erlernen muß, daß er künftighin sein Brot erwerbe, kam zu der Zeit der Pate und hieß ihn mit sich gehen in einen finsteren Wald. Da standen allerlei Kräuter, und der Tod sprach: »Jetzt, mein Pat, sollt du dein Patengeschenk von mir empfahen. Du sollt ein Doktor über alle Doktoren werden durch das rechte wahre Heilkraut, das ich dir jetzt in die Hand gebe. Doch merke, was ich dir sage. Wenn man dich zu einem Kranken beruft, so wirst du meine Gestalt jedesmal erblicken.
Stehe ich zu Häupten des Kranken, so darfst du versichern, daß du ihn gesund machen wollest, und ihn von dem Kraute eingeben; wenn er aber Erde kauen muß, so stehe ich zu des Kranken Füßen; dann sage nur: Hier kann kein Arzt der Welt helfen und auch ich nicht. Und brauche ja nicht das Heilkraut gegen meinen mächtigen Willen, so würde es dir übel ergehen!«
 Damit ging der Tod von hinnen und der junge Mensch auf die Wanderung und es dauerte gar nicht lange, so ging der Ruf vor ihm her und der Ruhm, dieser sei der größte Arzt auf Erden, denn er sahe es gleich den Kranken an, ob sie leben oder sterben würden. Und so war es auch. Wenn dieser Arzt den Tod zu des Kranken Füßen erblickte, so seufzte er, und sprach ein Gebet für die Seele des Abscheidenden; erblickte er aber des Todes Gestalt zu Häupten, so gab er ihm einige Tropfen, die er aus dem Heilkraut preßte, und die Kranken genasen. Da mehrte sich sein Ruhm von Tage zu Tage.
Damit ging der Tod von hinnen und der junge Mensch auf die Wanderung und es dauerte gar nicht lange, so ging der Ruf vor ihm her und der Ruhm, dieser sei der größte Arzt auf Erden, denn er sahe es gleich den Kranken an, ob sie leben oder sterben würden. Und so war es auch. Wenn dieser Arzt den Tod zu des Kranken Füßen erblickte, so seufzte er, und sprach ein Gebet für die Seele des Abscheidenden; erblickte er aber des Todes Gestalt zu Häupten, so gab er ihm einige Tropfen, die er aus dem Heilkraut preßte, und die Kranken genasen. Da mehrte sich sein Ruhm von Tage zu Tage.
Nun geschah es, daß der Wunderarzt in ein Land kam, dessen König schwer erkrankt darnieder lag, und die Hofärzte gaben keine Hoffnung mehr seines Aufkommens. Weil aber die Könige am wenigsten gern sterben, so hoffte der alte König noch ein Wunder zu erleben, nämlich daß der Wunderdoktor ihn gesund mache, ließ diesen berufen und versprach ihm den höchsten Lohn. Der König hatte aber eine Tochter, die war so schön und so gut, wie ein Engel.
Als der Arzt in das Gemach des Königs kam, sah er zwei Gestalten an dessen Lager stehen, zu Häupten die schöne weinende Königstochter, und zu Füßen den kalten Tod. Und die Königstochter flehte ihn so rührend an, den geliebten Vater zu retten, aber die Gestalt des finstern Paten wich und wankte nicht. Da sann der Doktor auf eine List. Er ließ von raschen Dienern das Bette des Königs schnell umdrehen, und gab ihm geschwind einen Tropfen vom Heilkraut, also daß der Tod betrogen war, und der König gerettet. Der Tod wich erzürnt von hinnen, erhob aber drohend den langen knöchernen Zeigefinger gegen seinen Paten.
Dieser war in Liebe entbrannt gegen die reizende Königstochter, und sie schenkte ihm ihr Herz aus inniger Dankbarkeit. Aber bald darauf erkrankte sie schwer und heftig, und der König, der sie über alles liebte, ließ bekannt machen, welcher Arzt sie gesund mache, der solle ihr Gemahl und hernach König werden. Da flammte eine hohe Hoffnung durch des Jünglings Herz, und er eilte zu der Kranken – aber zu ihren Füßen stand der Tod. Vergebens warf der Arzt seinem Paten flehende Blicke zu, daß er seine Stelle verändern und ein wenig weiter hinauf, wo möglich bis zu Häupten der Kranken treten möge. Der Tod wich nicht von der Stelle, und die Kranke schien im Verscheiden, doch sah sie den Jüngling um ihr Leben flehend an. Da übte des Todes Pate noch einmal seine List, ließ das Lager der Königstochter schnell umdrehen, und gab ihr geschwind einige Tropfen vom Heilkraut, so daß sie wieder auflebte, und den Geliebten dankbar anlächelte. Aber der Tod warf seinen tödlichen Haß auf den Jüngling, faßte ihn an mit eiserner eiskalter Hand und führte ihn von dannen, in eine weite unterirdische Höhle. In der Höhle da brannten viele tausend Kerzen, große und halbgroße und kleine und ganz kleine; viele verloschen und andere entzündeten sich, und der Tod sprach zu seinem Paten: »Siehe, hier brennt eines jeden Menschen Lebenslicht; die großen sind den Kindern, die halbgroßen sind den Leuten, die in den besten Jahren stehen, die kleinen den Alten und Greisen, aber auch Kinder und Junge haben oft nur ein kleines bald verlöschendes Lebenslicht.«
»Zeige mir doch das meine!« bat der Arzt den Tod, da zeigte dieser auf ein ganz kleines Stümpchen, das bald zu erlöschen drohte. »Ach liebster Pate!« bat der Jüngling: »wolle mir es doch erneuen, damit ich meine schöne Braut, die Königstochter, freien, ihr Gemahl und König werden kann!« – »Das geht nicht« – versetzte kalt der Tod. »Erst muß eins ganz ausbrennen, ehe ein neues auf- und angesteckt wird.« –
»So setze doch gleich das alte auf ein neues!« sprach der Arzt – und der Tod sprach: »Ich will so tun!« Nahm ein langes Licht, tat als wollte er es aufstecken, versah es aber absichtlich und stieß das kleine um, daß es erlosch. In demselben Augenblick sank der Arzt um und war tot.
Ludwig Bechstein
(1801 – 1860)
Gevatter Tod
Sämtliche Märchen
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive A-B, Bechstein, Bechstein, Ludwig, Tales of Mystery & Imagination

The Little Vagabond
Dear mother, dear mother, the Church is cold;
But the Alehouse is healthy, and pleasant, and warm.
Besides, I can tell where I am used well;
The poor parsons with wind like a blown bladder swell.
But, if at the Church they would give us some ale,
And a pleasant fire our souls to regale,
We’d sing and we’d pray all the livelong day,
Nor ever once wish from the Church to stray.
Then the Parson might preach, and drink, and sing,
And we’d be as happy as birds in the spring;
And modest Dame Lurch, who is always at church,
Would not have bandy children, nor fasting, nor birch.
And God, like a father, rejoicing to see
His children as pleasant and happy as he,
Would have no more quarrel with the Devil or the barrel,
But kiss him, and give him both drink and apparel.
William Blake
(1757 – 1827)
The Little Vagabond
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive A-B, Archive A-B, Blake, William, Tales of Mystery & Imagination

The Grey Monk
“I die, I die!” the Mother said,
“My children die for lack of bread.
What more has the merciless Tyrant said?”
The Monk sat down on the stony bed.
The blood red ran from the Grey Monk’s side,
His hands and feet were wounded wide,
His body bent, his arms and knees
Like to the roots of ancient trees.
His eye was dry; no tear could flow:
A hollow groan first spoke his woe.
He trembled and shudder’d upon the bed;
At length with a feeble cry he said:
“When God commanded this hand to write
In the studious hours of deep midnight,
He told me the writing I wrote should prove
The bane of all that on Earth I lov’d.
My Brother starv’d between two walls,
His Children’s cry my soul appalls;
I mock’d at the rack and griding chain,
My bent body mocks their torturing pain.
Thy father drew his sword in the North,
With his thousands strong he marched forth;
Thy Brother has arm’d himself in steel
To avenge the wrongs thy Children feel.
But vain the Sword and vain the Bow,
They never can work War’s overthrow.
The Hermit’s prayer and the Widow’s tear
Alone can free the World from fear.
For a Tear is an intellectual thing,
And a Sigh is the sword of an Angel King,
And the bitter groan of the Martyr’s woe
Is an arrow from the Almighty’s bow.
The hand of Vengeance found the bed
To which the Purple Tyrant fled;
The iron hand crush’d the Tyrant’s head
And became a Tyrant in his stead.”
William Blake
(1757 – 1827)
The Grey Monk
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive A-B, Archive A-B, Blake, William, Tales of Mystery & Imagination

Der Kranke
Zitternd auf der Berge Säume
Fällt der Sonne letzter Strahl,
Eingewiegt in düstre Träume
Blickt der Kranke in das Tal,
Sieht der Wolken schnelles Jagen
Durch das trübe Dämmerlicht —
Ach, des Busens stille Klagen
Tragen ihn zur Heimat nicht!
Und mit glänzendem Gefieder
Zog die Schwalbe durch die Luft,
Nach der Heimat zog sie wieder,
Wo ein milder Himmel ruft;
Und er hört ihr fröhlich Singen,
Sehnsucht füllt des Armen Blick,
Ach, er sah sie auf sich schwingen,
Und sein Kummer bleibt zurück.
Schöner Fluß mit blauem Spiegel,
Hörst du seine Klagen nicht?
Sag’ es seiner Heimat Hügel,
Daß des Kranken Busen bricht.
Aber kalt rauscht er vom Strande
Und entrollt ins stille Tal,
Schweiget in der Heimat Lande
Von des Kranken stiller Qual.
Und der Arme stützt die Hände
An das müde, trübe Haupt;
Eins ist noch, wohin sich wende
Der, dem aller Trost geraubt;
Schlägt das blaue Auge wieder
Mutig auf zum Horizont,
Immer stieg ja Trost hernieder
Dorther, wo die Liebe wohnt.
Und es netzt die blassen Wangen
Heil’ger Sehnsucht stiller Quell,
Und es schweigt das Erdverlangen,
Und das Auge wird ihm hell:
Nach der ew’gen Heimat Lande
Strebt sein Sehnen kühn hinauf,
Sehnsucht sprengt der Erde Bande,
Psyche schwingt zum Licht sich auf.
Wilhelm Hauff
(1802 – 1827)
Der Kranke, Gedicht
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive G-H, Archive G-H, Hauff, Hauff, Wilhelm, Tales of Mystery & Imagination
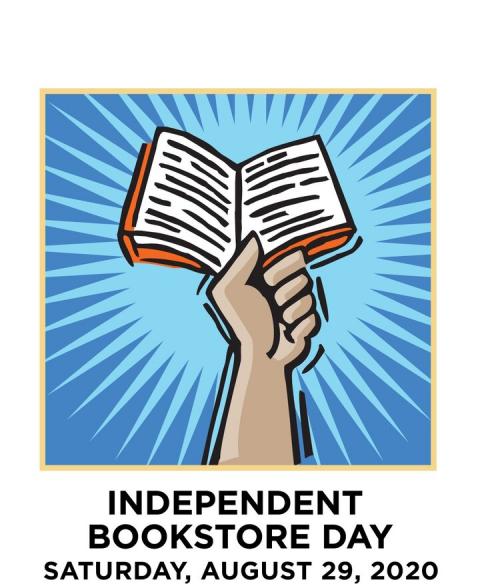
Independent Bookstore Day
saturday august 29, 2020
• more on website indiebookstoreday
• https://www.indiebookstoreday.com/
• fleursdumal.nl magazine
More in: - Book Lovers, - Book News, - Bookstores, Art & Literature News, AUDIO, CINEMA, RADIO & TV, FDM in New York, The Art of Reading

To The Muses
Whether on Ida’s shady brow,
Or in the chambers of the East,
The chambers of the sun, that now
From ancient melody have ceas’d;
Whether in Heav’n ye wander fair,
Or the green corners of the earth,
Or the blue regions of the air,
Where the melodious winds have birth;
Whether on crystal rocks ye rove,
Beneath the bosom of the sea
Wand’ring in many a coral grove,
Fair Nine, forsaking Poetry!
How have you left the ancient love
That bards of old enjoy’d in you!
The languid strings do scarcely move!
The sound is forc’d, the notes are few!
William Blake
(1757 – 1827)
To The Muses
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive A-B, Archive A-B, Blake, William, Tales of Mystery & Imagination
Das Märchen vom Ritter Blaubart
Es war einmal ein gewaltiger Rittersmann, der hatte viel Geld und Gut, und lebte auf seinem Schlosse herrlich und in Freuden. Er hatte einen blauen Bart, davon man ihn nur Ritter Blaubart nannte, obschon er eigentlich anders hieß, aber sein wahrer Name ist verloren gegangen.
 Dieser Ritter hatte sich schon mehr als einmal verheiratet, allein man hätte gehört, daß alle seine Frauen schnell nacheinander gestorben seien, ohne daß man eigentlich ihre Krankheit erfahren hatte. Nun ging Ritter Blaubart abermals auf Freiersfüßen, und da war eine Edeldame in seiner Nachbarschaft, die hatte zwei schöne Töchter und einige ritterliche Söhne, und diese Geschwister liebten einander sehr zärtlich. Als nun Ritter Blaubart die eine dieser Töchter heiraten wollte, hatte keine von beiden rechte Lust, denn sie fürchteten sich vor des Ritters blauem Bart, und mochten sich auch nicht gern voneinander trennen. Aber der Ritter lud die Mutter, die Töchter und die Brüder samt und sonders auf sein großes schönes Schloß zu Gaste, und verschaffte ihnen dort so viel angenehmen Zeitvertreib und so viel Vergnügen durch Jagden, Tafeln, Tänze, Spiele und sonstige Freudenfeste, daß sich endlich die jüngste der Schwestern ein Herz faßte, und sich entschloß, Ritter Blaubarts Frau zu werden. Bald darauf wurde auch die Hochzeit mit vieler Pracht gefeiert.
Dieser Ritter hatte sich schon mehr als einmal verheiratet, allein man hätte gehört, daß alle seine Frauen schnell nacheinander gestorben seien, ohne daß man eigentlich ihre Krankheit erfahren hatte. Nun ging Ritter Blaubart abermals auf Freiersfüßen, und da war eine Edeldame in seiner Nachbarschaft, die hatte zwei schöne Töchter und einige ritterliche Söhne, und diese Geschwister liebten einander sehr zärtlich. Als nun Ritter Blaubart die eine dieser Töchter heiraten wollte, hatte keine von beiden rechte Lust, denn sie fürchteten sich vor des Ritters blauem Bart, und mochten sich auch nicht gern voneinander trennen. Aber der Ritter lud die Mutter, die Töchter und die Brüder samt und sonders auf sein großes schönes Schloß zu Gaste, und verschaffte ihnen dort so viel angenehmen Zeitvertreib und so viel Vergnügen durch Jagden, Tafeln, Tänze, Spiele und sonstige Freudenfeste, daß sich endlich die jüngste der Schwestern ein Herz faßte, und sich entschloß, Ritter Blaubarts Frau zu werden. Bald darauf wurde auch die Hochzeit mit vieler Pracht gefeiert.
Nach einer Zeit sagte der Ritter Blaubart zu seiner jungen Frau: »Ich muß verreisen, und übergebe dir die Obhut über das ganze Schloß, Haus und Hof, mit allem, was dazu gehört. Hier sind auch die Schlüssel zu allen Zimmern und Gemächern, in alle diese kannst du zu jeder Zeit eintreten. Aber dieser kleine goldne Schlüssel schließt das hinterste Kabinett am Ende der großen Zimmerreihe. In dieses, meine Teure, muß ich dir verbieten zu gehen, so lieb dir meine Liebe und dein Leben ist. Würdest du dieses Kabinett öffnen, so erwartet dich die schrecklichste Strafe der Neugier. Ich müßte dir dann mit eigner Hand das Haupt vom Rumpfe trennen!« – Die Frau wollte auf diese Rede den kleinen goldnen Schlüssel nicht annehmen, indes mußte sie dies tun, um ihn sicher aufzubewahren, und so schied sie von ihrem Mann mit dem Versprechen, daß es ihr nie einfallen werde, jenes Kabinett aufzuschließen und es zu betreten.
Als der Ritter fort war, erhielt die junge Frau Besuch von ihrer Schwester und ihren Brüdern, die gerne auf die Jagd gingen; und nun wurden mit Lust alle Tage die Herrlichkeiten in den vielen vielen Zimmern des Schlosses durchmustert, und so kamen die Schwestern auch endlich an das Kabinett. Die Frau wollte, obschon sie selbst große Neugierde trug, durchaus nicht öffnen, aber die Schwester lachte ob ihrer Bedenklichkeit, und meinte, daß Ritter Blaubart darin doch nur aus Eigensinn das Kostbarste und Wertvollste von seinen Schätzen verborgen halte. Und so wurde der Schlüssel mit einigem Zagen in das Schloß gesteckt, und da flog auch gleich mit dumpfem Geräusch die Türe auf, und in dem sparsam erhellten Zimmer zeigten sich – ein entsetzlicher Anblick! – die blutigen Häupter aller früheren Frauen Ritter Blaubarts, die ebensowenig, wie die jetzige, dem Drang der Neugier hatten widerstehen können, und die der böse Mann alle mit eigner Hand enthauptet hatte. Vom Tod geschüttelt, wichen jetzt die Frauen und ihre Schwester zurück; vor Schreck war der Frau der Schlüssel entfallen, und als sie ihn aufhob, waren Blutflecke daran, die sich nicht abreiben ließen, und ebensowenig gelang es, die Türe wieder zuzumachen, denn das Schloß war bezaubert, und indem verkündeten Hörner die Ankunft Berittner vor dem Tore der Burg. Die Frau atmete auf und glaubte, es seien ihre Brüder, die sie von der Jagd zurück erwartete, aber es war Ritter Blaubart selbst, der nichts Eiligeres zu tun hatte, als nach seiner Frau zu fragen, und als diese ihm bleich, zitternd und bestürzt entgegentrat, so fragte er nach dem Schlüssel; sie wollte den Schlüssel holen und er folgte ihr auf dem Fuße, und als er die Flecken am Schlüssel sah, so verwandelten sich alle seine Geberden, und er schrie: »Weib, du mußt nun von meinen Händen sterben! Alle Gewalt habe ich dir gelassen! Alles war dein! Reich und schön war dein Leben! Und so gering war deine Liebe zu mir, du schlechte Magd, daß du meine einzige geringe Bitte, meinen ernsten Befehl nicht beachtet hast? Bereite dich zum Tode! Es ist aus mit dir!«
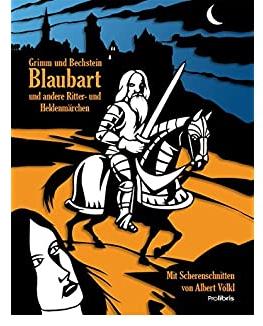 Voll Entsetzen und Todesangst eilte die Frau zu ihrer Schwester, und bat sie, geschwind auf die Turmzinne zu steigen und nach ihren Brüdern zu spähen, und diesen, sobald sie sie erblicke, ein Notzeichen zu geben, während sie sich auf den Boden warf, und zu Gott um ihr Leben flehte. Und dazwischen rief sie: »Schwester! Siehst du noch niemand!« – »Niemand!« klang die trostlose Antwort. – »Weib! komm herunter!« schrie Ritter Blaubart, »deine Frist ist aus!«
Voll Entsetzen und Todesangst eilte die Frau zu ihrer Schwester, und bat sie, geschwind auf die Turmzinne zu steigen und nach ihren Brüdern zu spähen, und diesen, sobald sie sie erblicke, ein Notzeichen zu geben, während sie sich auf den Boden warf, und zu Gott um ihr Leben flehte. Und dazwischen rief sie: »Schwester! Siehst du noch niemand!« – »Niemand!« klang die trostlose Antwort. – »Weib! komm herunter!« schrie Ritter Blaubart, »deine Frist ist aus!«
»Schwester! siehst du niemand?« schrie die Zitternde. »Eine Staubwolke – aber ach, es sind Schafe!« antwortete die Schwester. – »Weib! komm herunter, oder ich hole dich!« schrie Ritter Blaubart.
»Erbarmen! Ich komme ja sogleich! Schwester! siehst du niemand?« – »Zwei Ritter kommen zu Roß daher, sie sahen mein Zeichen, sie reiten wie der Wind.« –
»Weib! Jetzt hole ich dich!« donnerte Blaubarts Stimme, und da kam er die Treppe herauf. Aber die Frau gewann Mut, warf ihre Zimmertüre ins Schloß, und hielt sie fest, und dabei schrie sie samt ihrer Schwester so laut um Hülfe, wie sie beide nur konnten. Indessen eilten die Brüder wie der Blitz herbei, stürmten die Treppe hinauf und kamen eben dazu, wie Ritter Blaubart die Türe sprengte und mit gezücktem Schwert in das Zimmer drang. Ein kurzes Gefecht und Ritter Blaubart lag tot am Boden. Die Frau war erlöst, konnte aber die Folgen ihrer Neugier lange nicht verwinden.
Ludwig Bechstein
(1801 – 1860)
Das Märchen vom Ritter Blaubart
Sämtliche Märchen
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive A-B, Bechstein, Bechstein, Ludwig, Tales of Mystery & Imagination

An Emilie
Zum Garten ging ich früh hinaus,
Ob ich vielleicht ein Sträußchen finde?
Nach manchem Blümchen schaut’ ich aus,
Ich wollt’s für dich zum Angebinde;
Umsonst hatt’ ich mich hinbemüht,
Vergebens war mein freudig Hoffen;
Das Veilchen war schon abgeblüht,
Von andern Blümchen keines offen.
Und trauernd späht’ ich her und hin,
Da tönte zu mir leise, leise
Ein Flüstern aus der Zweige Grün,
Gesang nach sel’ger Geister Weise;
Und lieblich, wie des Morgens Licht
Des Tales Nebelhüllen scheidet,
Ein Röschen aus der Knospe bricht,
Das seine Blätter schnell verbreitet.
»Du suchst ein Blümchen?« spricht’s zu mir,
»So nimm mich hin mit meinen Zweigen,
Bring mich zum Angebinde ihr!
Ich bin der wahren Freude Zeichen.
Ob auch mein Glanz vergänglich sei,
Es treibt aus ihrem treuen Schoße
Die Erde meine Knospen neu,
Drum unvergänglich ist die Rose.
Und wie mein Leben ewig quillt
Und Knosp’ um Knospe sich erschließet,
Wenn mich die Sonne sanft und mild
Mit ihrem Feuerkuß begrüßet,
So deine Freundin ewig blüht,
Beseelt vom Geiste ihrer Lieben,
Denn ob der Rose Schmelz verglüht —
Der Rose Leben ist geblieben.«
Wilhelm Hauff
(1802 – 1827)
An Emilie, Gedicht
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive G-H, Hauff, Hauff, Wilhelm, Tales of Mystery & Imagination
Siebenschön
Es waren einmal in einem Dorfe ein paar arme Leute, die hatten ein kleines Häuschen und nur eine einzige Tochter, die war wunderschön und gut über alle Maßen. Sie arbeitete, fegte, wusch, spann und nähte für sieben, und war so schön wie sieben zusammen, darum ward sie Siebenschön geheißen. Aber weil sie ob ihrer Schönheit immer von den Leuten angestaunt wurde, schämte sie sich, und nahm sonntags, wenn sie in die Kirche ging – denn Siebenschön war auch frömmer wie sieben andre, und das war ihre größte Schönheit – einen Schleier vor ihr Gesicht.
 So sah sie einstens der Königssohn, und hatte seine Freude über ihre edle Gestalt, ihren herrlichen Wuchs, so schlank wie eine junge Tanne, aber es war ihm leid, daß er vor dem Schleier nicht auch ihr Gesicht sah, und fragte seiner Diener einen: »Wie kommt es, daß wir Siebenschöns Gesicht nicht sehen?« – »Das kommt daher« – antwortete der Diener: »weil Siebenschön so sittsam ist.« Darauf sagte der Königssohn: »Ist Siebenschön so sittsam zu ihrer Schönheit, so will ich sie lieben mein lebenlang und will sie heiraten. Gehe du hin und bringe ihr diesen goldnen Ring von mir und sage ihr, ich habe mit ihr zu reden, sie solle abends zu der großen Eiche kommen.« Der Diener tat wie ihm befohlen war, und Siebenschön glaubte, der Königssohn wolle ein Stück Arbeit bei ihr bestellen, ging daher zur großen Eiche und da sagte ihr der Prinz, daß er sie lieb habe um ihrer großen Sittsamkeit und Tugend willen, und sie zur Frau nehmen wolle; Siebenschön aber sagte: »Ich bin ein armes Mädchen und du bist ein reicher Prinz, dein Vater würde sehr böse werden, wenn du mich wolltest zur Frau nehmen.
So sah sie einstens der Königssohn, und hatte seine Freude über ihre edle Gestalt, ihren herrlichen Wuchs, so schlank wie eine junge Tanne, aber es war ihm leid, daß er vor dem Schleier nicht auch ihr Gesicht sah, und fragte seiner Diener einen: »Wie kommt es, daß wir Siebenschöns Gesicht nicht sehen?« – »Das kommt daher« – antwortete der Diener: »weil Siebenschön so sittsam ist.« Darauf sagte der Königssohn: »Ist Siebenschön so sittsam zu ihrer Schönheit, so will ich sie lieben mein lebenlang und will sie heiraten. Gehe du hin und bringe ihr diesen goldnen Ring von mir und sage ihr, ich habe mit ihr zu reden, sie solle abends zu der großen Eiche kommen.« Der Diener tat wie ihm befohlen war, und Siebenschön glaubte, der Königssohn wolle ein Stück Arbeit bei ihr bestellen, ging daher zur großen Eiche und da sagte ihr der Prinz, daß er sie lieb habe um ihrer großen Sittsamkeit und Tugend willen, und sie zur Frau nehmen wolle; Siebenschön aber sagte: »Ich bin ein armes Mädchen und du bist ein reicher Prinz, dein Vater würde sehr böse werden, wenn du mich wolltest zur Frau nehmen.
« Der Prinz drang aber noch mehr in sie, und da sagte sie endlich, sie wolle sich’s bedenken, er solle ihr ein paar Tage Bedenkzeit gönnen. Der Königssohn konnte aber unmöglich ein paar Tage warten, er schickte schon am folgenden Tage Siebenschön ein Paar silberne Schuhe und ließ sie bitten, noch einmal unter die große Eiche zu kommen. Da sie nun kam, so fragte er schon, ob sie sich besonnen habe? sie aber sagte, sie habe noch keine Zeit gehabt sich zu besinnen, es gebe im Haushalt gar viel zu tun, und sie sei ja doch ein armes Mädchen und er ein reicher Prinz, und sein Vater werde sehr böse werden, wenn er, der Prinz, sie zur Frau nehmen wolle. Aber der Prinz bat von neuem und immermehr, bis Siebenschön versprach, sich gewiß zu bedenken und ihren Eltern zu sagen, was der Prinz im Willen habe. Als der folgende Tag kam, da schickte der Königssohn ihr ein Kleid, das war ganz von Goldstoff, und ließ sie abermals zu der Eiche bitten.
Aber als nun Siebenschön dahin kam, und der Prinz wieder fragte, da mußte sie wieder sagen und klagen, daß sie abermals gar zu viel und den ganzen Tag zu tun gehabt, und keine Zeit zum Bedenken, und daß sie mit ihren Eltern von dieser Sache auch noch nicht habe reden können, und wiederholte auch noch einmal, was sie dem Prinzen schon zweimal gesagt hatte, daß sie arm, er aber reich sei, und daß er seinen Vater nur erzürnen werde. Aber der Prinz sagte ihr, das alles habe nichts auf sich, sie solle nur seine Frau werden, so werde sie später auch Königin, und da sie sah, wie aufrichtig der Prinz es mit ihr meinte, so sagte sie endlich ja, und kam nun jeden Abend zu der Eiche und zu dem Königssohne – auch sollte der König noch nichts davon erfahren. Aber da war am Hofe eine alte häßliche Hofmeisterin, die lauerte dem Königssohn auf, kam hinter sein Geheimnis und sagte es dem Könige an. Der König ergrimmte, sandte Diener aus und ließ das Häuschen, worin Siebenschöns Eltern wohnten, in Brand stecken, damit sie darin anbrenne. Sie tat dies aber nicht, sie sprang als sie das Feuer merkte heraus und alsbald in einen leeren Brunnen hinein, ihre Eltern aber, die armen alten Leute verbrannten in dem Häuschen.
 Da saß nun Siebenschön drunten im Brunnen und grämte sich und weinte sehr, konnt’s aber zuletzt doch nicht auf die Länge drunten im Brunnen aushalten, krabbelte herauf, fand im Schutt des Häuschens noch etwas Brauchbares, machte es zu Geld und kaufte dafür Mannskleider, ging als ein frischer Bub an des Königs Hof und bot sich zu einem Bedienten an. Der König fragte den jungen Diener nach dem Namen, da erhielt er die Antwort: »Unglück!« und dem König gefiel der junge Diener also wohl, daß er ihn gleich annahm, und auch bald vor allen andern Dienern gut leiden konnte.
Da saß nun Siebenschön drunten im Brunnen und grämte sich und weinte sehr, konnt’s aber zuletzt doch nicht auf die Länge drunten im Brunnen aushalten, krabbelte herauf, fand im Schutt des Häuschens noch etwas Brauchbares, machte es zu Geld und kaufte dafür Mannskleider, ging als ein frischer Bub an des Königs Hof und bot sich zu einem Bedienten an. Der König fragte den jungen Diener nach dem Namen, da erhielt er die Antwort: »Unglück!« und dem König gefiel der junge Diener also wohl, daß er ihn gleich annahm, und auch bald vor allen andern Dienern gut leiden konnte.
Als der Königssohn erfuhr, daß Siebenschöns Häuschen verSiebenschönbrannt war, wurde er sehr traurig, glaubte nicht anders, als Siebenschön sei mit verbrannt, und der König glaubte[180] das auch, und wollte haben, daß sein Sohn nun endlich eine Prinzessin heirate, und mußte dieser nun eines benachbarten Königs Tochter freien. Da mußte auch der ganze Hof und die ganze Dienerschaft mir zur Hochzeit ziehen, und für Unglück war das am traurigsten, es lag ihm wie ein Stein auf dem Herzen. Er ritt auch mit hintennach der Letzte im Zuge, und sang wehklagend mit klarer Stimme:
»Siebenschön war ich genannt,
Unglück ist mir jetzt bekannt.«
Das hörte der Prinz von weitem, und fiel ihm auf und hielt und fragte: »Ei wer singt doch da so schön?« – »Es wird wohl mein Bedienter, der Unglück sein«, antwortete der König, »den ich zum Diener angenommen habe.« Da hörten sie noch einmal den Gesang:
»Siebenschön war ich genannt,
Unglück ist mir jetzt bekannt.«
Da fragte der Prinz noch einmal, ob das wirklich niemand anders sei, als des Königs Diener? und der König sagte er wisse es nicht anders.
Als nun der Zug ganz nahe an das Schloß der neuen Braut kam, erklang noch einmal die schöne klare Stimme:
»Siebenschon war ich genannt,
Unglück ist mir jetzt bekannt.«
 Jetzt wartete der Prinz keinen Augenblick länger, er spornte sein Pferd und ritt wie ein Offizier längs des ganzen Zugs in gestrecktem Galopp hin, bis er an Unglück kam, und Siebenschön erkannte. Da nickte er ihr freundlich zu und jagte wieder an die Spitze des Zuges, und zog in das Schloß ein. Da nun alle Gäste und alles Gefolge im großen Saal versammelt war und die Verlobung vor sich gehen sollte, so sagte der Prinz zu seinem künftigen Schwiegervater: »Herr König, ehe ich mit Eurer Prinzessin Tochter mich feierlich verlobe, wollet mir erst ein kleines Rätsel lösen. Ich besitze einen schönen Schrank, dazu verlor ich vor einiger Zeit den Schlüssel, kaufte mir also einen neuen; bald darauf fand ich den alten wieder, jetzt saget mir Herr König, wessen Schlüssel ich mich bedienen soll?« – »Ei natürlich des alten wieder!« antwortete der König, »das Alte soll man in Ehren halten, und es über Neuem nicht hintansetzen.« – »Ganz wohl Herr König«, antwortete nun der Prinz, »so zürnt mir nicht, wenn ich Eure Prinzessin Tochter nicht freien kann, sie ist der neue Schlüssel, und dort steht der alte.« Und nahm Siebenschön an der Hand und führte sie zu seinem Vater, indem er sagte: »Siehe Vater, das ist meine Braut.« Aber der alte König rief ganz erstaunt und erschrocken aus: »Ach lieber Sohn, das ist ja Unglück, mein Diener!« – Und viele Hofleute schrieen: »Herr Gott, das ist ja ein Unglück!« – »Nein!« sagte der Königssohn, »hier ist gar kein Unglück, sondern hier ist Siebenschön, meine liebe Braut.« Und nahm Urlaub von der Versammlung und führte Siebenschön als Herrin und Frau auf sein schönstes Schloß.
Jetzt wartete der Prinz keinen Augenblick länger, er spornte sein Pferd und ritt wie ein Offizier längs des ganzen Zugs in gestrecktem Galopp hin, bis er an Unglück kam, und Siebenschön erkannte. Da nickte er ihr freundlich zu und jagte wieder an die Spitze des Zuges, und zog in das Schloß ein. Da nun alle Gäste und alles Gefolge im großen Saal versammelt war und die Verlobung vor sich gehen sollte, so sagte der Prinz zu seinem künftigen Schwiegervater: »Herr König, ehe ich mit Eurer Prinzessin Tochter mich feierlich verlobe, wollet mir erst ein kleines Rätsel lösen. Ich besitze einen schönen Schrank, dazu verlor ich vor einiger Zeit den Schlüssel, kaufte mir also einen neuen; bald darauf fand ich den alten wieder, jetzt saget mir Herr König, wessen Schlüssel ich mich bedienen soll?« – »Ei natürlich des alten wieder!« antwortete der König, »das Alte soll man in Ehren halten, und es über Neuem nicht hintansetzen.« – »Ganz wohl Herr König«, antwortete nun der Prinz, »so zürnt mir nicht, wenn ich Eure Prinzessin Tochter nicht freien kann, sie ist der neue Schlüssel, und dort steht der alte.« Und nahm Siebenschön an der Hand und führte sie zu seinem Vater, indem er sagte: »Siehe Vater, das ist meine Braut.« Aber der alte König rief ganz erstaunt und erschrocken aus: »Ach lieber Sohn, das ist ja Unglück, mein Diener!« – Und viele Hofleute schrieen: »Herr Gott, das ist ja ein Unglück!« – »Nein!« sagte der Königssohn, »hier ist gar kein Unglück, sondern hier ist Siebenschön, meine liebe Braut.« Und nahm Urlaub von der Versammlung und führte Siebenschön als Herrin und Frau auf sein schönstes Schloß.
Ludwig Bechstein
(1801 – 1860)
Siebenschön
Sämtliche Märchen
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive A-B, Bechstein, Bechstein, Ludwig, Tales of Mystery & Imagination

Ah! Would I Could Forget
The whispering water rocks the reeds,
And, murmuring softly, laps the weeds;
And nurses there the falsest bloom
That ever wrought a lover’s doom.
Forget me not! Forget me not!
Ah! would I could forget!
But, crying still, “Forget me not,”
Her image haunts me yet.
We wander’d by the river’s brim,
The day grew dusk, the pathway dim;
Her eyes like stars dispell’d the gloom,
Her gleaming fingers pluck’d the bloom.
Forget me not! Forget me not!
Ah! would I could forget!
But, crying still, “Forget me not,”
Her image haunts me yet.
The pale moon lit her paler face,
And coldly watch’d our last embrace,
And chill’d her tresses’ sunny hue,
And stole that flower’s turquoise blue.
Forget me not! Forget me not!
Ah! would I could forget!
But, crying still, “Forget me not,”
Her image haunts me yet.
The fateful flower droop’d to death,
The fair, false maid forswore her faith;
But I obey a broken vow,
And keep those wither’d blossoms now!
Forget me not! Forget me not!
Ah! would I could forget!
But, crying still, “Forget me not,”
Her image haunts me yet.
Sweet lips that pray’d–“Forget me not!”
Sweet eyes that will not be forgot!
Recall your prayer, forego your power,
Which binds me by the fatal flower.
Forget me not! Forget me not!
Ah! would I could forget!
But, crying still, “Forget me not,”
Her image haunts me yet.
Juliana Horatia Ewing
(1841–1885)
Poem
Ah! Would I Could Forget
• fleursdumal.nl magazine
More in: Archive E-F, Archive E-F, Juliana Horatia Ewing, Tales of Mystery & Imagination
Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature